|
|
|
Umschlagtext
Der Schwerpunkt des Buches besteht darin, dem Leser empirisch begründete Befunde, Orientierungen und praktisches Know-How in Bezug auf die Effektivität verschiedener Interventionsformen im Bereich der Lese- und Rechtschreibförderung (Legasthenie) zu vermitteln. Dies wird auf der Basis empirischer experimenteller Arbeiten überblickshaft für die Bereiche der Frühförderung (phonologisches Wissen), des Erstlese- und Schreibunterrichts (basal-phonologisches Vorgehen, Arbeiten mit Silben, Sprach-erfahrungsansatz) sowie der Rechtschreibförderung auf Basis des Morphemansatzes dokumentiert.
Das Buch bietet eine ausführliche Darstellung von Förder-Praxisbeispielen, die auch die Entwicklung und Effektivität von computergestützten Verfahren einbeziehen sowie zahlreiche praxisrelevante mediendidaktische Anregungen. Rezension
Das Buch stellt wissenschaftliche Versuche und Studien zur LRS sowie deren Befunde und Ergebnisse vor.
Nach der Einleitung im ersten Kapitel erfolgt im zweiten Kapitel die Darstellung und Kritik des traditionellen Verständnisses der LRS. Die Untersuchungen belegen auf eindrucksvolle Weise, dass bisher allgemein akzeptierte Erklärungen der Ursachen der LRS so nicht haltbar sind, auch wenn sie zunächst plausibel erscheinen. Hierzu gehört vor allem die Vorstellung von grundsätzlichen Defiziten in der akustischen und visuellen Wahrnehmung. Im dritten Kapitel werden dann Studien und deren Befunde zu kognitions- und entwicklungspsychologischen Ansätzen vorgestellt und erläutert. Im Vordergrund steht hierbei die Vorstellung, dass sich das Lesen als informationsverarbeitender Prozess mit klar voneinander abgrenzbaren Einzelkompetenzen konzeptionalisieren lässt. Im vierten Kapitel werden Studien und deren Ergebnisse zu möglichen Interventions- und Fördermaßnahmen auf Grundlage von Silben und Morphemen vorgestellt und erläutert. Den Ansätzen auf Morphembasis kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Hierfür werden konkrete Methoden und Fördervorschläge insbesondere unter Anwendung des Computers gegeben. Auf der Internetseite des Autors (http://www.uni-kiel.de/ewf/heilpaedagogik/) besteht die Möglichkeit unter anderem das Programm Lese-Zeile (V 3.0) kostenlos herunterzuladen. Die theoretischen Überlegungen, Vorgehensweise, Durchführung und Ergebnisse der Versuche und Studien werden ausführlich dargestellt und erläutert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der statistischen Auswertung des empirisch gewonnenen Materials. Dort wo unterschiedliche oder nicht konsistente Befunde auftreten werden mögliche Fehlerquellen diskutiert. Durch die genaue Darstellung erhält der Leser die Möglichkeit die Versuche und ihre Ergebnisse nachzuvollziehen. Das Buch hat somit Modellcharakter und kann als Leitfaden für die Forschungspraxis genutzt werden. Zum vollen Verständnis der Ausführungen sind Kenntnisse in Statistik erforderlich. Da einige Autoren aus dem anglo-amerikanischen Raum im Original zitiert werden, sind entsprechende Englischkenntnisse ebenfalls erforderlich. Menschlich beeindruckend im Rahmen des Forschungskontextes ist die Anerkennung kognitiver Leistungen, auch wenn diese oft nicht sofort erkennbar sind. So macht der Autor ausdrücklich darauf aufmerksam, dass z.B. Schreibweisen wie Loite für Leute oder a für er am Wortende sehr wohl mit den Prinzipien der deutschen Rechtschreibung im Einklang zu bringen sind, bzw. aufgrund von Dialekten zu begründen sind, auch wenn dies nicht der vorgegebenen Norm entspricht. Bei der Abwertung entsprechender Leistungen ist also Vorsicht geboten. Am Ende des Buches befindet sich auf 36 Seiten ein ca. 550 Titel umfassendes Literaturverzeichnis, das dem Leser eine vertiefende Arbeit ermöglicht. Eine vertiefende Darstellung der Frage, warum LRS-Schüler überhaupt Schwierigkeiten bei den einzelnen Teilleistungen haben wäre sicherlich wünschenswert gewesen, ist aber nicht Gegenstand des Buches. Leider haben sich im Buch einige Druckfehler eingeschlichen. Unter anderem: So drückt die graphische Darstellung, bzw. die Beschriftung der Abbildung 58 auf Seite 235 genau das Gegenteil des Textes aus. Nach den Ausführungen des Autors ist die Morphemsegmentierung der Silbensegmentierung überlegen und nicht umgekehrt. Die Tabelle 57B auf Seite 240 enthält unter der Lautangabe (K oder V) den Buchstaben e statt V für Vokal. Außerdem ist die Spalte zur Lautstruktur fälschlich mit "Graphem" überschrieben, obwohl die lautliche Äußerung betrachtet wird. In der Tabelle 56 auf Seite 237 ist ein Teil der Wörter falsch zugeordnet worden. So ist z.B. das Wort "dumm" sicherlich kein Beispiel für die phonologische Komplexität KVKK sondern KVK. Es wird nicht zweimal das "m" gesprochen sondern der U-laut wird verkürzt. Die Graphik auf Seite 118 ist mit der auf Seite 64 identisch. Außerdem sind folgende Textstellen identisch: S. 264 und S. 214 (unterer Teil), Kasten S. 265 und S. 216, S. 62 und S. 42. Eine Überarbeitung wäre bei einer Neuauflage wünschenswert. Die herausragende Qualität des Buches wird dadurch jedoch nicht in Frage gestellt. Das Buch ist eine hervorragende Darstellung empirischer Studien und deren Befunde zur LRS. Fazit: Pflichtlektüre für alle, die im Bereich LRS tätig sind und wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse für ihre Arbeit benötigen. Björn Hillen, lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung und Lesehilfe
2. Die traditionell ausgerichtete Legasthenieforschung: Annahmen, Konzepte, Kritik und Konsequenzen für die Förderung 2.1 Lese-Rechtschreibschwäche gleich Legasthenie?! 2.2 Die cerebral-funktionelle Interpretation von Lese-Rechtschreib-störungen (klassische Legasthenie) nach SCHENK-DANZIGER 2.2.1 Konzeptionelle Annahmen und ihre Schwächen 2.2.2 Der legasthenietypische Fehler und seine konzeptionell-diagnostische Problematik 2.2.3 Der cerebral-funktionelle Ansatz und seine Konsequenzen für die Förderpraxis 2.3 Kognitive Funktionsstörungen als Ursache von Lese-Rechtschreibschwäche: Zusammenhänge und Trainingsbefunde 2.3.1 Visuelle Wahrnehmug und die Wirksamkeit ihres Trainings auf die Lese-Rechtschreibleistungen 2.3.2 Eine alternative Interpretation: Visuelle Wahrnehmungsfehler im Spannungsfeld zwischen allgemein kognitiven Funktionen und spezifischen Teilprozessen 2.4 Allgemein sprachliche Funktionen, Intelligenz, Konzentration und ihre Zusammenhänge mit Lese-Rechtschreibleistungen 2.5 Legasthenie oder Lautnuancentaubheit 2.6 Die Problematik der Lautdiskriminationstests 2.7 Akustische Wahrnehmungsfehler: Einige ausgewählte Beispiele aus diagnostischen Rechtschreibtests und deren Interpretation 2.8 Die kongenitale Legasthenie 3. Kognitions- und entwicklungspsychologisch orientierte Ansätze: Lese- rechtschreibschwierigkeiten als die Problematik gestörter sprachlich-kognitiver Informationsverarbeitung und deren Entwicklung 3.1 Der Leseprozeß und das Verständnis des alphabetischen Prinzips unseres Schriftsystems 3.2 Das Modellieren des Wortleseprozesses als Voraussetzung für eine theoriegeleitete Forschung und Förderpraxis 3.3 Förderdiagnostik und Prognose von Lese-Rechtschreibleistungen im Vorschulalter: das Konzept des phonologischen Wissens 3.3.1 Vorteile und Probleme früher Diagnose und Vorhersage von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten 3.3.2 Generelle Befunde: Phonologisches Wissen als Prädikator für den Schriftspracherwerb 3.3.3 Phonologische Informationsverarbeitung: Verschiedene Aufgabentypen eines summarischen Konzepts? 3.3.4 Die Entwicklung der phonologischen Bewußtheit im Vorschul- und frühen Schulalter 3.3.5 Deutschsprachige Untersuchungen: Phonologisches Wissen als Prädikator und Folge des Schriftspracherwerbs 3.3.6 Schriftspracherwerb und phonologisches Wissen: Experimentelle Interventionsstudien und Längsschnittbefunde 3.3.7 Förder-Praxisbeispiele: Möglichkeiten der Frühdiagnose und Frühförderung mit spezifischen phonologisch ausgerichteten Analyse- und Synthesetrainings 3.4 Ergebnisse der experimentellen Leseforschung hinsischtlich der Wortwahrnehmung und des Leseprozesses 3.4.1 Theoretische Annahmen zu Mechanismen der Wortwahrnehmung 3.4.2 Empirische Befunde zu Mechanismen der Redundanzausnutzung 3.4.3 Das Erkennen sinnvoller Wörter und Annahme über mögliche Verarbeitungseinheiten 3.4.4 Phonologische und nicht-phonologische Kodes und der Zugriff ins interne Lexikon 3.5 Wortidentifikation und reifes Lesen als Funktion der Kontextausnutzung 3.5.1 Wortlesen und Kontextausnutzung: Empirische Befunde 3.5.2 Empirische Befunde hinsischtlich der Kontextausnutzung im Leseprozeß bei Förderschülern und eigene Untersuchungen 3.5.3 Didaktisch methodische Schlußfolgerungen: Leselernen auf der Wortebene oder im Satzzusammenhang? 3.5.4 Der Spracherfahrungsansatz für den Anfangsunterricht: Empirische Befunde und didaktisch-methodische Konsequenzen 4. Möglöiche verarbeitungseinheitendes Worterkennens: Silbe und Morphem als Grundlage für spezifische und praxisrelevante Fördermaßnahmen 4.1 Die Silbe als mögliche Verarbeitungseinheit 4.1.1 Silbe versus Phonem 4.1.2 Die Silbe: visuelle Aspekte 4.1.3 Silbensegmentierung und Leseleistung 4.2 Didaktische-methodische Folgerungen auf Basis der Einheit Silbe 4.2.1 Allgemeine Förderbefunde auf nationaler und internationaler Ebene 4.2.2 Ein Förder-Praxisbeispiel: Computerunterstützte Leseförderung auf Silbenbasis - Fördermöglichkeiten und deren Effektivität 4.3 Morphemorientierte Rechtschreib- und Wortschatzförderung bei Lernschwachen: Konzepte, Erfahrungen, Methoden und Medien 4.3.1 Das Morphem als didaktisch relevante Einheit für den Schriftspracherwerb 4.3.2 Findet sich für die morphologische Struktur der Sprache eine kognitive Repräsentanz? 4.3.3 Der Zugang ins interne Lexikon mittels Morphemeinheiten: Die Modellvorstellungen und empirische Befunde von TAFT und FORSTER 4.3.4 Der Einfluß der Silben- und Morphemsegmentierung auf das Erkennen sinnvoller Wörter: Versuch einer integrierenden Betrachtungsweise sowie eigene Befunde 4.3.5 Vorschläge für die didaktisch-methodische Nutzung der Befunde zum Erkennen sinnvoller Wörter 4.3.6 Experimentell-empirische Interventionsstudien und Praxiserfahrungen mit morphemorientierten Rechtschreibkonzepten 4.3.7 Rechtschreiben: Die entwicklungspsychologische Perspektive und das Formulieren von Voraussetzungs-Hypothesen 4.3.8 Ein Praxisbeispiel: Effekte eines kognitions- und lernpsychologisch orientierten Rechtschreibtrainings auf Morphembasis bei sehr schwachen Förderschülern 5. Zusammenfassung und Schluß: Plädoyer für bereichsspezifische und funktionsanalytisch ausgerichtete Förderkonzepte 6. Literatur |
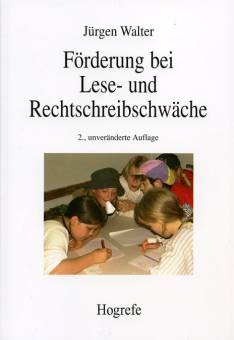
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen