|
|
|
Umschlagtext
Fachkulturforschung existiert bislang vor allem in Bezug auf universitäre Disziplinen. Die Kulturen schulischer Unterrichtsfächer und der Zusammenhang von schulischen Fachkulturen und Unterrichtsqualität (bzw. ‚erfolgreichen’ Bildungsgängen) ist bislang kaum untersucht worden. Dieses Versäumnis greift der Sammelband auf: Im Durchgang durch methodische Überlegungen, Einzelbeschreibungen schulischer Fachkulturen und Perspektiven auf den Zusammenhang von Fachkultur und Bildungsgang wird der Rahmen für eine ‚Fachkulturforschung in der Schule’ entworfen.
Rezension
Zur Professionalisierung der Lehrerbildung fordert der renommierte Schul- und Unterrichtsforscher Ewald Terhart eine forschende Fachdidaktik an den Universitäten. Während die Fakultäten oft über ausreichend fachwissenschaftliche Professorenstellen verfügen, gibt es in der bundesrepublikanischen Hochschullandschaft nur wenige Lehrstühle für die Didaktik und Methodik einzelner Unterrichtsfächer. Dadurch werden für die Lehrerbildung zentrale Forschungsgebiete marginalisiert, nämlich die Erforschung der Fachkulturen.
Zu diesem Thema erschien 2007 der von Jenny Lüders herausgegebene Band „Fachkulturforschung in der Schule“ im „Verlag Barbara Budrich“. Fachkulturforschung bezieht sich nicht nur auf die Beschäftigung mit den fachlichen Inhalten, sondern die Wissensbereiche werden „als komplexe Handlungsfelder mit ihren Sinnkonstruktionen, Glaubenssystemen, Ritualen und Gewohnheiten, Sprech-und Handlungsweisen“ (S. 7f.) begriffen. Fachkulturen sind nach Lüders „eine entscheidende Bedingung für die Bildungsprozesse von Lernenden (und Lehrenden).“(S. 8) Daher beschränkt sich dieser der Hochschulsozialisationsforschung entnommenen Ansatz nicht auf die Generierung deskriptiver Forschungsresultate, sondern zielt auch auf die Entwicklung von Unterrichtsskripten und Lernumgebungen ab. Als langfristiges Ziel wird eine verbesserte Unterrichtspraxis und Lehrerbildung verfolgt. Fachkulturforschung ist also im Kontext der Schul- und Unterrichtsentwicklung zu sehen. Das als Band 18 der „Studien zur Bildungsgangforschung“ erschienene Buch beleuchtet das Thema „Fachkulturforschung“ sowohl unter metatheoretischer als auch objekttheoretischer Perspektive. In dem Großkapitel „Methodologische Perspektiven“ wird zunächst von Katharina Müller-Roselius der Begriff „Fachkultur“ unter Bezugnahme auf Pierre Bourdieus Habitus-Konzept näher analysiert. Uwe Hericks und Andreas Körber stellen in ihrem Beitrag vor, wie in der Fachkulturforschung quantitative und rekonstruktive Methoden miteinander produktiv miteinander verbunden werden können. Johannes Bastian und Arno Combe begreifen in ihrem Aufsatz „Fachkulturforschung als Entwicklungsforschung“. Sehr aufschlussreich ist auch der Beitrag des mittlerweile emeritierten Professors für Schulpädagogik Meinert A. Meyer, der in seiner Abhandlung die Zusammenhänge von Fachkultur, Lernkultur und der von ihm begründeten Bildungsgangdidaktik elaboriert. Seine Hauptthese lautet, dass die Probleme des Fachunterrichts nicht durch eine Gegenüberstellung von lehrerzentriertem Frontalunterricht und schülerzentrierten Unterricht adäquat erfasst werden können (S. 206). Vielmehr sollten der „Bildungsgang – das ‚biographische Gepäck‘ und die antizipierten Zielsetzungen, die Entwicklungsaufgaben, die die Schülerinnen und Schüler in den Unterrichtsprozess einbringen – für die Planung und Gestaltung des Unterrichts“(S. 191) in der Unterrichtsforschung mehr Berücksichtigung finden. Dem Thema "Würdigung von Schülern und deren Leistungen" widmet sich Hericks in seinem Beitrag „Anerkennung im Fachunterricht“. Wie sich die Fachkulturforschung in den einzelnen Fächern konkretisiert, zeigen die anderen Aufsätze des Buchs auf. Das Verhältnis von Fachunterricht und fächerübergreifenden Unterricht, auf das zwar in einzelnen Beiträgen des Werks kursorisch eingegangen wird, wäre allerdings noch näher zu untersuchen. Fazit: Der vorliegende Band „Fachkulturforschung in der Schule“ aus dem „Verlag Barbara Budrich“ zeigt mögliche Entwicklungsperspektiven zukünftiger Schul- und Unterrichtsforschung auf, die hermeneutisch-konstruktive und empirische Ansätze miteinander produktiv integrieren. Daher verdient das Buch Beachtung von den Didaktikern, den Fachleiter bzw. -beratern und von den forschenden Lehrern. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Fachkulturforschung in der Schule 7
Katharina Müller-Roselius, Habitus und Fachkultur 15 I. Methodologie der Fachkulturforschung Uwe Hericks und Andreas Körber, Vergleichende quantitative und qualitative Fachkulturforschung in der Schule 31 Johannes Bastian und Arno Combe, Fachkulturforschung als Entwicklungsforschung 49 II. Schulische Fachkulturen Uwe Gellert, Zur Kulturalität von Mathematik in Schule und Unterricht 65 Barbara Schenk, Fachkultur und Bildung in den Fächern Chemie und Physik 83 Kerstin Michalik und Lydia Murmann, Sachunterricht - zur Fachkultur eines Integrationsfaches 101 Bodo von Borries, Internationale und internationale Differenzen der 'Fachkultur Geschichte' - Empirische Indizien 117 Matthias Trautmann, Fachkultur Englisch – Was wissen wir darüber? 137 Katharina Willems, Doing gender while doing disciplin? Zur Macht der Illusio in den Unterrichtsfächern Physik und Deutsch 151 III. Fachkultur und Bildungsgang Helene Decke-Cornill, Ulrich Gebhard, Jenseits der Fachkulturen 171 Meinert Meyer, Fachkultur, Lernkultur und und Bildungsgang 191 Uwe Hericks, Anerkennung im Fachunterricht 209 Autorinnen und Autoren 229 |
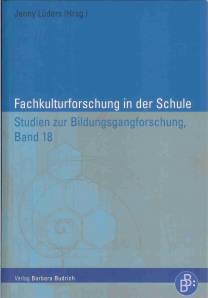
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen