|
|
|
Umschlagtext
In der Parabel von den drei Ringen streiten die Brüder über das Erbe, das sie von ihrem Vater bekommen haben. Juden, Christen und Muslime waren sich im Mittelalter sehr bewusst, dass ihre Traditionen miteinander verwandt sind. Die Historikerin Dorothea Weltecke zeigt, dass ihre konfliktreiche und dennoch gemeinsame Geschichte in dem großen Raum zwischen Atlantik, Nil und Indus überhaupt erst die exklusiven «Religionen» hervorgebracht hat.
Rezension
Auf die Frage, seit wann Religionen existieren, wird gemeinhin geantwortet, seitdem religiöse Praktiken und Rituale nachweisbar sind, also seit 42.000 Jahren. Dieser gängigen Sicht widerspricht Dorothea Weltecke (*1967) in ihrer neuer Monographie „Die drei Ringe. Warum die Religionen erst im Mittelalter entstanden sind“. Erschienen ist der Band der Professorin für Europäische Geschichte des Mittelalters an der Humboldt-Universität Berlin in der „Historischen Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung“ bei C.H. Beck. Weltecke ist ausgewiesene Experten für Religionen und ihres Austausches in der Region Afro-Eurasien während des Mittelalters, genauer für ihre Polyzentrik und Pluralität.
Dieser Ansatz liegt auch ihrem aktuellen Buch zugrunde, dessen Titel Bezug nimmt auf Gotthold Ephraim Lessings berühmte Ringparabel aus seinem Drama „Nathan der Weise“. So kann Weltecke nachweisen, dass in Afro-Eurasien erst im Mittelalter die Entwicklung von Glaubenstraditionen zu Religionen erfolgte. Letztere zeichnen sich ihrer Ansicht nach durch einen absolutem Wahrheitsanspruch aus. Die Wissenschaftlerin geht also von einem sehr engen Religionsbegriff aus. In ihrer Monographie zeigt Weltecke auf u.a. anhand von Reiseberichten, religiösen Handreichungen, Zusammenfassungen und Religionsgesprächen, dass im Mittelalter keineswegs von Beginn an eine Exklusion und Bekämpfung anderer Glaubenstraditionen vorherrschend war, sondern interreligiöse Austauschprozesse und Konkurrenz dominierten. Erst durch besondere Machtkonstellationen und damit verbundener Verrechtlichungsprozesse hätten sich im Spätmittelalter eigenständige Religionen, deren Mitglieder sich klar voneinander abgrenzten, herausgebildet. Daher sei es auch nicht angemessen, bei der Betrachtung der tausendjährigen Geschichte des Mittelalters von „dem Christentum“, „dem Judentum“ oder „dem Islam“ zu sprechen. Auch das Begriffspaar „Toleranz/Intoleranz“ könne aufgrund seiner binären Codierung der komplexen Wirklichkeit im Mittelalter nicht gerecht werden. Ihre Erkenntnisse kann Weltecke anhand luzider Interpretation von Quellentexten, von denen vielfach (deutsche) Übersetzungen fehlen, untermauern. So lernt man beispielsweise mit der „Geschichte von Mar Jahbalaha und Rabban Sauma“, verfasst zu Beginn des 14. Jahrhunderts auf Aramäisch, die mittelalterliche Welt durch die Brille zweier uigurischer Mönche zu sehen. Außerdem erfährt man Aufschlussreiches über die unterschiedlichen Rezeptionen der Ringparabel, die sich zuerst im „Dekamaron“ von Giovanni Boccaccio nachweisen lässt. Lehrkräfte der Fächer Geschichte und Religion werden durch den vorliegenden Band motiviert, sich differenziert mit der Entwicklung von Glaubenstraditionen im Mittelalter auseinanderzusetzen. Fazit: Dorothea Weltecke leistet mit ihrer augenöffnenden Monographie „Die drei Ringe“ einen wichtigen Beitrag zur historischen Aufklärung über das Verhältnis und die Genese von Religionen im globalen Mittelalter. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Weltecke, Dorothea Die drei Ringe Warum die Religionen erst im Mittelalter entstanden sind. In der Parabel von den drei Ringen streiten die Brüder über das Erbe, das sie von ihrem Vater bekommen haben. Juden, Christen und Muslime waren sich im Mittelalter sehr bewusst, dass ihre Traditionen miteinander verwandt sind. Die Historikerin Dorothea Weltecke zeigt, dass ihre konfliktreiche und dennoch gemeinsame Geschichte in dem großen Raum zwischen Atlantik, Nil und Indus überhaupt erst die exklusiven «Religionen» hervorgebracht hat. Das Grab des Propheten Ezechiel in der Nähe von Bagdad war im Mittelalter Ziel von jüdischen, muslimischen und christlichen Pilgern. An diesem und vielen anderen Beispielen zeigt Dorothea Weltecke anschaulich, wie intensiv sich die Glaubensgemeinschaften austauschten. Gemeinsam bauten sie eine neue kulturelle Landschaft. Dass ihre Traditionen miteinander verwandt waren, wussten Juden, Christen und Muslime im Mittelalter. In der Parabel von den drei Ringen streiten die Brüder jedoch über das Erbe, das sie von ihrem gemeinsamen Vater bekommen haben. Problematisch für das Verhältnis der Glaubensgemeinschaften zueinander wurden im Mittelalter nicht ihre Wahrheitsansprüche, sondern neue rechtliche Unterscheidungen zwischen Gläubigen, nur Geduldeten und Nichtgeduldeten. Die Theorien und die Gewalt, mit denen diese Ungleichheit fortlaufend begründet und aufrechterhalten wurde, militarisierten die Grenzen zwischen den Glaubenstraditionen. Damit legt das Buch eindrucksvoll eine Schicht der Religionsgeschichte frei, die vom Lavastrom der Polemik verschüttet wurde. Inhaltsverzeichnis
Verflochtene Traditionen zwischen Antike und Neuzeit 11
Erster Teil: Orientierung in einer neuen historischen Landschaft 19 1. Vor der europäischen Hegemonie 21 2. Ausblenden ist eine Technik 42 3. Vor dem Zeitalter der Religionen 60 4. Gesetze, Treue, Lehren 69 Raum, Zeit, Ritual 69 | Treue zum «Gesetz» 84 | Lehre und Wissen 94 5. Brennpunkte einer gemeinsamen Geschichte 109 Das Grab des Propheten Ezechiel bei Bagdad 110 | Orte der Verehrung in Jerusalem 116 | Konvergenz, Rivalität und Macht 124 6. Grenzzäune verbinden 131 Zweiter Teil: Lehrdefinitionen und Zugehörigkeiten 139 1. Rabbaniten, Karäer und andere Gemeinden 144 Petachja aus Regensburg begegnet Juden und Minim 144 | 8 | Inhalt Benjamin von Tudela macht Unterschiede 152 | Qirqissani über Karäer und andere Juden 162 2. Kirchen und Häretiker 173 Apostolische Kirchen in der Zeit von Rabban Sauma und Mar Jahbalaha 174 | «Über Häresien» aus reichskirchlichen Perspektiven 185 3. Ulama, die Gelehrten 199 Schulen und Lehren in Ibn Dschubairs Pilgerbericht 199 | Náubachti und die Gefolgschaften 209 4. Polyzentrik und die Verflechtung von Glaubenstraditionen 218 Dritter Teil: Was die Ringparabeln erzählen 223 1. Die Parabel von den drei Ringen 227 Boccaccios Version 227 | Lateinische Christen orientieren sich 231 | Willkür oder Freundschaft 238 | Der Streit der Glaubenstraditionen als Familiengeschichte 242 2. Geschichten von Einem 249 Die Perle 249 | Der König und die Betrüger 255 | Der Klügere isst alles auf 262 | Unteilbar 272 | Theologengezänk und die Grenzen des Wissens 277 3. Eine gemeinsame Kultur der Unterweisung 284 Vierter Teil: Wahrheit und soziale Ordnung 289 1. Schreibarten des absoluten Wahrheitsanspruchs 293 Kritik am Establishment: Álvaro Pelayo 293 | Wahrheit als Schutz: Maimonides 300 | Prediger in der Kreuzzugszeit: Ali aus Herat 307 2. Erkundung der Skala 316 Zweifel am Glauben: SaɆadja und Georg 316 | Inhalt | 9 Die Gleichheit der Beweise: Ibn Hasm 325 | Das Heil der Ungläubigen 336 | Sich den Hass aus dem Herzen reißen: Bar Ebrojo 358 3. Unversöhnlichkeit und Dialog im sozialen Kontext 369 Fünfter Teil: Herrschaft und Wahrheit 381 1. Der Dichter Süßkind und sein Herr 385 2. Was Religionsgespräche erzählen 393 Macht macht Wahrheit 397 | Theodor vertraut dem System 410 | Der mächtigste Gott und seine Getreuen 424 | Pro et contra: Versöhnung auf Lateinisch 442 | Jehuda Halevi spielt nicht mit 455 3. Soziale Hegemonie und Gewalt 468 Die Genese der Religionen 481 Anhang Dank 499 Zur Umschrift 501 Anmerkungen 503 Quellen und Literatur 549 Bild- und Kartennachweis 604 Personenregister 606 |
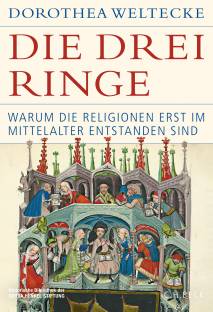
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen