|
|
|
Umschlagtext
Auch die moderne Welt ist eine von Religionen geprägte Welt: Viele Götter leben unter uns. Religiöse Glaubensformen und Sprachmuster beweisen in vielerlei Transformationen erstaunliche Beharrungskraft. Diesem Gegenwartsbefund verleiht das neue Buch des Münchener Theologen und Historikers Friedrich Wilhelm Graf historische Tiefenschärfe. Er analysiert anschaulich und pointiert die vielfach noch ungeschriebenen Religionsgeschichten der Moderne als Teil komplexer Wandlungsprozesse von Kulturen und Mentalitäten. Der Zeitrahmen spannt sich von den Religionsdebatten um 1800 bis zu den Menschenrechts- und Globalisierungsdiskursen des frühen 21. Jahrhunderts.
Rezension
Sie geht um, sie ist beliebt, sie wird behauptet: die These von der Wiederkehr der Religion, - besonders gern und mit durchaus unterschiedlichen Absichten vertreten durch den römischen Katholizismus oder durch den liberalen Kulturprotestantismus, wozu das hier anzuzeigende Buch zählt, das verschiedene Aufsätze des Verfassers überarbeitet dokumentiert. Der Mensch unheilbar religiös, die Rede vom Ende der Religion nur ein kurzes Intermezzo des späten 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, Religion als anthropologische Konstante inmitten der postmodernen Wandlungsprozesse von Kulturen und Mentalitäten, - und schließlich wird noch der 11. September bemüht zum Beleg der These … aber kann es so einfach gehen? Oder ist dieses letzte fundamentalistische Aufbäumen der Religion nicht selbst ultimativer Abgesang auf Religion und Moderne, deren letztes Spiegelbild nur der religiöse Fundamentalismus ist? Der liberale Protestantismus behauptet seit seiner Entstehung und jetzt mit neuer Emphase: Auch die moderne Welt ist von Religionen geprägt: Viele Götter leben unter uns, religiöse Glaubensformen und Sprachmuster beweisen in vielerlei Transformationen erstaunliche Beharrungskraft. Der oft behauptete Säkularismus der Moderne und die Verfallsmuster von Religion stellen kein zutreffendes Beschreibungsmodell dar, wie der Autor besonders in Kap. 2 verdeutlicht. Statt einer Auslöschung religiösen Bewusstseins müsse vielmehr mit zunehmender Differenzierung und Segmentierung gerechnet werden, wie der Autor am Beispiel des Konfessionalismus des 19. Jahrhunderts belegt.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Die rätselhafte Macht der Religionen Auch die moderne Welt ist von Religionen geprägt: Viele Götter leben unter uns. Religiöse Glaubensformen und Sprachmuster beweisen in vielerlei Transformationen erstaunliche Beharrungskraft. Diesem Gegenwartsbefund verleiht das neue Buch des Münchener Theologen und Historikers Friedrich Wilhelm Graf historische Tiefenschärfe. Er analysiert anschaulich und pointiert die vielfach noch ungeschriebenen Religionsgeschichten der Moderne als Teil komplexer Wandlungsprozesse von Kulturen und Mentalitäten. Der Zeitrahmen spannt sich von den Religionsdebatten um 1800 bis zu den Menschenrechts- und Globalisierungsdiskursen des frühen 21. Jahrhunderts. Besonderes Interesse gewinnt dabei die Auseinandersetzung mit aktuellen kulturwissenschaftlichen Deutungsmodellen und die programmatische Überwindung der Engführungen einer konfessionalistischen Religionsgeschichte. Der Autor Friedrich Wilhelm Graf, geb. 1948, ist Professor für Systematische Theologie und Ethik an der Universität München. Einem größeren Publikum ist er durch regelmäßige Beiträge in führenden Tageszeitungen bekannt. Als erster Theologe wurde er 1999 mit dem Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet. Arbeitsschwerpunkte: Kulturgeschichte des Christentums; Ideen- und Theologiegeschichte der Neuzeit; Wirtschafts- und Bioethik; Präsident der Ernst-Troeltsch-Gesellschaft. Pressestimmen: „Die Moderne führt offenbar nicht zwangsläufig zu einem Schwinden des Religiösen; man glaubt heute individueller, undogmatischer, vielfältiger, innerhalb wie außerhalb der Kirchen. Diesem Umstand versuchen die beiden zu besprechenden Bücher Rechnung zu tragen. (...) Ein Glanzstück des Buchs ist das Kapitel über die Religionsgeschichte der Moderne (...) Auf die Vielfalt kommt es Graf an; und er warnt vor den Vereinfachern (...)“ Balthasar Haußmann, Frankfurter Rundschau, 27. Juli 2004 „Wenn von der «Wiederkehr der Religion» in unserer Zeit gesprochen wird, ist die kulturdiagnostische Kamera oft mit einer unscharfen Linse bestückt. Man freut sich über das vielfältige religiöse Leben der Gegenwart. Steht der systematische Münchner Theologe und Ethiker Friedrich Wilhelm Graf hinter dem Apparat, so kann man sicher sein, dass das Objektiv sorgfältig gewählt, die Szene gut ausgeleuchtet, dass alles auf ein Maximum an Kontrast und Tiefenschärfe eingestellt ist. Schon der Titel seines Buches, «Die Wiederkehr der Götter», macht deutlich: Die Präsenz der Religion in der modernen Kultur kann nicht in einem harmonistischen Bild präsentiert werden. Graf nimmt im Buchtitel wie auch im Vorwort Bezug auf Max Webers Rede «Wissenschaft als Beruf» von 1917: «Die alten vielen Götter, entzaubert und daher in Gestalt unpersönlicher Mächte, entsteigen ihren Gräbern, streben nach Gewalt über unser Leben und beginnen untereinander wieder ihren ewigen Kampf.» (...) Beeindruckend sind Grafs analytische Kompetenz, seine argumentative Kraft und eine nicht nur postulierte, sondern auch praktizierte Verbindung von neuzeitlicher Religionswissenschaft und Theologie. Freilich hätte man in diesem dritten, Position beziehenden Teil gerne noch etwas mehr über die Grundlinien seines eigenen theologischen Drehbuchs erfahren. Die Schrift schliesst knapp mit einer Frage und folgender Antwort: «Wozu noch wissenschaftliche Theologie? Die Antwort kann in einer bündigen Formel gegeben werden: um in den Arenen von Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Kirche und Politik der heilsamen Unterscheidung von Gott und Mensch Geltung zu verschaffen.»" Niklaus Peter, Neue Zürcher Zeitung, 15. Juli 2004 „Der Autor entfaltet seine Argumente in drei Teilen: moderne Religion deuten, Religionsgeschichten der Moderne, das Eigenrecht des Normativen. Wer über Gott und Welt nachdenkt, muss sich mit dieser luziden Untersuchung auseinander setzen. Es lohnt sich!" Stephan Sattler, Focus, 10. April 2004 „Es gehört zu den großen Verdiensten von Graf, dass er das Aufflammen heiliger Kriege und religiöser Kulturkämpfe in den historischen Kontext stellt. Gerade die Moderne, so Graf, besitze ihre eigene Glaubensgeschichte, die von der göttlichen Erwähltheit der Nation über den Wissenschaftsglauben und den messianischen Avantgardismus der Weltkriegsepoche bis zu den politischen Theologien der Gegenwart reicht." Ludger Heidbrink, Die Zeit, 25. März 2004 „Hier hat sich jemand die Mühe gemacht, die neuesten Ergebnisse religionssoziologischer und -historischer Arbeiten prägnant und gut lesbar zusammenzufassen. Das ist eine undankbare Aufgabe für den Autor, aber ein Geschenk an den Leser. Der sorgfältige Anmerkungsapparat ist eine Goldgrube. Zudem bietet das Buch eine höchst niveauvolle Polemik gegen die methodischen Unzulänglichkeiten, die historische Ignoranz und politische Machtgier der postmodernen Cultural Studies." Jan Brachmann, Berliner Zeitung, 22. März 2004 Inhaltsverzeichnis
Vorwort 9
I. MODERNE RELIGION DEUTEN 15 a) Religious economics, oder: Religiöser Pluralismus im Marktmodell 19 b) Shared history, oder: Religiöser Pluralismus im Konfessionsvergleich 30 c) Das «religiöse Feld», oder: Religiöser Pluralismus im Unterscheidungskampf 50 II. RELIGIONSGESCHICHTEN DER MODERNE 69 1. «Dechristianisierung» 69 a) Zur Problemgeschichte eines kulturpolitischen Topos 70 b) «Fuga templi»: Krisendiagnostik um 1800. 71 c) Konzepte und Formen religiösen Wandels 79 d) Den Menschen ins Herz blicken? - Forschungsperspektiven 96 2. Die Nation - von Gott «erfunden»? 102 a) Die kulturalistische Wiederkehr der Religion 102 b) Religion als Deutungscode 111 c) Die religiöse «Erfindung» der Nation 116 d) Konfessionalität als Deutungskultur 129 3. Alter Geist und neuer Mensch 133 a) Religiöse Zukunftserwartungen um 1900 133 b) Die öffentliche Inszenierung der Religionsdiskurse 137 c) Die Geltungskrise der christlichen Kirchen. 152 d) Die «Renaissance des Judentums» 160 e) Die avantgardistische Religiosität des «neuen Menschen» 170 4. Gottes Stimme auf globalen Märkten 179 a) Wirtschaftshandeln und Weltwahrnehmung 179 b) Wirtschaftsethik und Kapitalismusmodelle. 181 c) Religion als bestimmende Kraft der Lebensführung 185 d) Okzidentaler Betriebskapitalismus und «innerweltliche Askese» 188 e) Globalisierung und religiöser Wandel 192 f) Differenzbewußtsein oder Öffnungszwang? 198 5. Religiöse Letzthorizonte - Risiko oder Chance für kulturelle Identitäten? 203 a) Die religiöse Tiefenprägung kultureller Selbstverständigungsprozesse 205 b) Zur kulturellen Deutungsfunktion von Religion 207 c) Der Streit um die Universalität der Menschenrechte 210 d) Von der Unverzichtbarkeit einer universalistischen Position 222 III.DAS EIGENRECHT DES NORMATIVEN. REFLEXIONEN IN POSTSÄKULARER ZEIT 227 1.Was leistet postmoderne Religionswissenschaft? 227 a) Radikaler Historismus, oder: Die Moderne war immer schon postmodern 229 b) Die neue Beschränktheit, oder: Vom Beobachten der Beobachter 239 c) Mitspieler im politischen Feld, oder: Von der impliziten Parteinahme der Religionswissenschaftler 243 2. Wozu noch Theologie? 249 a) Religiöse Vielfalt deuten können, oder: Theologie hat ihren Ort in der Universität 251 b) In den Wertehimmel der Kulturdeuter aufgenommen werden, oder: Theologie als Kulturwissenschaft des Christentums z6i c) Licht in den Weihrauch der politischen Sinnbildner bringen, oder: Von der Funktion der Theologie für die Gesellschaft 267 ANHANG Anmerkungen 281 Literaturhinweise 319 Personenregister 327 |
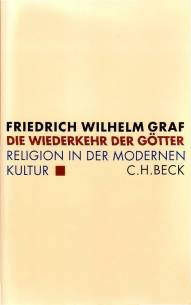
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen