|
|
|
Umschlagtext
Israel ist ein Land mit vielen Gesichtern. Kaum größer als das Bundesland Hessen, beherbergt es mehr als 100 Nationen aus allen Teilen der Welt, deren unterschiedliche soziale und kulturelle Herkunft im täglichen Miteinander nicht selten Anlass für Konflikte gibt. Wir begegnen «arabischen» Juden, die aus islamischen Staaten fliehen mussten; wir erleben junge israelische Muslime, die mehr über das Judentum wissen als die meisten Juden aus der Diaspora; wir treffen den israelischen Bill Gates, dessen Computertechnik weltweit erfolgreich exportiert wird; wir treten ein in die Welt des ultra-orthodoxen Juden, der bei seinen Patrouillen durch Teile von Jerusalem zu anständigem Verhalten anmahnt. In ihrem glänzend geschriebenen Buch zeichnet Donna Rosenthal ein sensibles Portrait dieses Landes zwischen Tradition und Moderne.
«Ein wunderbares Buch:gut recherchiert, ausgewogen, und eine Freude zu lesen.» Amir D. Aczel, Autor von «Rosenthal beschreibt die verschiedenen ethnischen und religiösen Subkulturen, jüdische und nicht-jüdische, die das pulsierende und zerbrechliche Mosaik der Israelischen Gesellschaft ausmachen.» Washington Post Rezension
Ein Buch - nicht nur für Menschen, die nach Israel reisen wollen oder sich speziell für die israelische Gesellschaft und den modernen Staat Israel interessieren, sondern ein Buch, das eine extrem multikulturelle Gesellschaft in einer noch extremeren politischen Grenzsituation beschreibt. Was mir an diesem Buch sehr gefällt: die ausgewogene, abwägende, offene, kritische Darstellung; ein flüssiger, lebendiger, interessanter Stil, der zu fesseln vermag; eine Thematik, die spannender kaum sein kann und in mancherlei Hinsicht erhellendes Licht nicht nur auf die aktuelle politische Situation Israels wirft, sondern auch z.T. exemplarisch steht für gesellschaftliche Entwicklungen an anderen Orten, - nur, dass sie sich hier verdichtet vorfinden.
Dieter Bach, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Leben in einem außergewöhnlichen Land Israel ist ein Land mit vielen Gesichtern. CNN zeichnet ein anderes Bild als al-Jazeera. Die BBC hat ihre Version, die F.A.Z. eine andere. Kaum größer als das Bundesland Hessen, beherbergt Israel mehr als 100 Nationen aus allen Teilen der Welt, deren unterschiedliche soziale und kulturelle Herkunft im täglichen Miteinander nicht selten Anlass für Konflikte gibt. Donna Rosenthal lässt die Menschen mit ihren Hoffnungen und Wünschen zu Wort kommen und zeichnet dabei ein sensibles Portrait dieses Landes zwischen Tradition und Moderne. "Ein wunderbares Buch: gut recherchiert, ausgewogen, und eine Freude zu lesen." Amir D. Aczel, Autor des Buches "Fermats letzter Satz" „Rosenthal fängt ein ganzes Land ein, ein Land voller Dramatik und Bewegung.“ Publishers Weekly Seit über 50 Jahren stehen Israel und der Nahostkonflikt im Zentrum des weltpolitischen Interesses. Wie sich aber das alltägliche Leben in diesem heterogenen, stets im Wandel begriffenen Land darstellt, ist weit weniger bekannt. Dieses Buch erzählt von den ganz normalen Menschen, ihren Hoffnungen und ihrem Alltag in Israel. Donna Rosenthal zeigt uns ein Land voller Widersprüche und kultureller Gegensätze. Wir lernen den ultra-orthodoxen Juden kennen, der schaut, ob religiöse Frauen in Bussen auch getrennt von Männern sitzen; wir treffen die Braut, deren in Äthiopien geborene Eltern ihren Ehemann ablehnen, weil er ihnen nicht jüdisch genug ist; wir begegnen der jungen mutigen Beduinin, die gegen den Widerstand der Familie und des Stammes ein Studium in der Stadt aufnimmt, oder lernen muslimische Israelis kennen, die von ihren Enttäuschungen, ihrer Verzweiflung und ihren Hoffnungen berichten. Wir erleben die junge, säkulare jüdische Generation, deren Helden nicht mehr Generäle sind, sondern Menschen, die ein zweites Silicon Valley im Land errichteten und Israel zu einem High-tech-Land gemacht haben. Die Autorin zeichnet ein farbiges Panorama dieses widersprüchlichen Landes. Sie erzählt die Geschichten der Menschen in ihren kollidierenden Welten zwischen einem traditionellen und einem radikal modernen Leben. Entstanden ist ein äußerst lebendiges, intimes und faszinierendes Bild einer Gesellschaft im Umbruch. Donna Rosenthal hat unter anderem für die „New York Times“, die „Washington Post“, die „Los Angeles Times“ und für „Newsweek“ geschrieben. Sie war Reporterin für das Israelische Radio und die „Jerusalem Post“ und lehrte an der Hebrew University. Sie erhielt den Lowell Thomas Award für die beste investigative Berichterstattung. „Wie eine Computertomographie liefert Donna Rosenthals Buch Querschnittsbilder der zahlreichen ethischen, sozialen, kulturellen Schichten, die in ihrer Gesamtheit das Bild des Israeli ausmachen. Was in der Totalansicht verwirrend bunt, mitunter auch als unverträgliche Mischung erscheint, unterteilt sie fein säuberlich, erhellt historische und tagespolitische Hintergründe, ohne aber den einzelnen Menschen aus dem Blick zu verlieren. Sie gibt Einblicke in sein Seelenleben und in die Widersprüche der israelischen Gesellschaft. Sie erläutert Spannungen zwischen Neueinwanderern und Alteingesessenen, zwischen jüdischen und nichtjüdischen Israelis – allein 1,2 Millionen muslimische Bürger leben im jüdischen Staat Israel. Und durch die russische Einwanderung seit den 90-er Jahren hat auch die Zahl derjenigen zugenommen, die lieber Weihnachten anstelle von Chanukka feiern. Bei der Lektüre des verständlich und informativ geschriebenen Buches wundert man sich hin und wieder, dass bei solch hohem Maß an Disparatem auf engstem Raum der Staat als solcher überhaupt funktioniert. Carsten Hueck, Deutschlandradio, 15. Februar 2007 „In Israel spiegelt sich noch immer die ganze Welt, wo der deutsche Professor und die kurdische Höhlenbewohnerin, der jemenitische Silberschmied und die New Yorker Rabbinerfrau auf kleinem Raum zusammentrafen. (…) Wer über all das etwas erfahren möchte, der findet in Donna Rosenthals Untersuchung ein lebendig geschriebenes Panorama der Gesellschaft. Rosenthals Verdienst ist es, auch dort recherchiert zu haben, wo andere oft nicht hinschauen. Ganze Kapitel widmet sie den Beduinen, Drusen, Äthiopiern oder schlicht den Christen, einer Gemeinschaft von immerhin 150 000 (meist arabischen) Seelen. Die Autorin erklärt was die „Misrachim“ – die arabischstämmigen Juden – von jenen vornehmen Sepharden unterscheidet, die sich von den einst so bedeutenden jüdischen Gemeinden im mittelalterlichen Spanien herleiten und denen wiederum die bis heute tonangebenden (europäischen) Aschkenasim gegenüberstehen. (…) eine lesenwerte Darstellung.“ Claudia Kühner, Tagesanzeiger, 12. Februar 2007 Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Kollidierende Welten
Teil I: Israeli werden Kapitel 1: Eines der unsichersten Wohnviertel der Welt Kapitel 2: Partnersuche und Paarungsverhalten auf israelisch Kapitel 3: Eine Armee des Volkes Kapitel 4: Schwerter in Wertpapiere Teil II: Eine Nation, viele Stämme Kapitel 5: Die Ashkenasim Kapitel 6: Die Mizrahim – Die anderen Israelis Kapitel 7: Die Russen – Der neue Exodus Kapitel 8: Aus Afrika – Äthiopische Israelis im Gelobten Land Teil III: Grabenbrüche zwischen Juden und Juden Kapitel 9: Die Haredim – Jüdisch-Jüdisch-Jüdisch Kapitel 10: Die Orthodoxen – Dieses Land ist dein Land? Dieses Land ist mein Land! Kapitel 11: Die Nichtorthodoxen – Der Krieg der Cheeseburger Teil IV: Schizophrenie: Nichtjuden in einem jüdischen Staat Kapitel 12: Die Muslime – Abrahams andere Kinder Kapitel 13: Die Beduinen – Stämme, Zelte und Satellitenschüsseln Kapitel 14: Die Drusen – Zwischen Moderne und Tradition Kapitel 15: Die Christen – Ungebetene Gäste im Lande Jesu Epilog Shalom/Salaam Leseprobe: Kapitel 1 Eines der unsichersten Wohnviertel der Welt «Es ist unter Umständen schwieriger, mit Terrorismus klar zu kommen, als mit Krieg. Krieg unterliegt geografischen und zeitlichen Begrenzungen. Der Terrorismus kennt keine Grenzen.» Solly Dreman, klinischer Psychologe der Abteilung für Verhaltenswissenschaften der Ben-Gurion-Universität im Negev Rahamin Zigkiyahu, ein leidenschaftlicher Fußballfan, bekniete seinen Vorgesetzten, ihn für den Frühbus einzuteilen, so dass er am Nachmittag frei haben würde und sich das WM-Spiel zwischen Japan und der Türkei würde anschauen können. Sein Boss sagte Nein. Doch dann erschien der eingeteilte Fahrer nicht pünktlich zum Dienst, für Rahamin ein Zeichen, dass Gott ihm wohlgesinnt war. Nur allzu gern sprang er ein und übernahm den Frühbus. An diesem Morgen des 18. Juni 2002 war der Bus der Linie 32A in Jerusalem dicht besetzt mit Schulkindern und Berufspendlern: ein Junge mit Kippa und Pferdeschwanz und mit einem Rucksack, länger als seine Rückenpartie; das langjährige Hausmädchen des israelischen Präsidenten; eine Ingenieurin, die aus Russland ausgewandert war, nachdem dort Landsleute ihren Mann verprügelt hatten, nur weil er es gewagt hatte, in der Öffentlichkeit seine Kippa zu tragen; junge arabische Israelis auf dem Weg zur Pädagogischen Hochschule, an der sie studierten; Juden, Muslime und Christen. Rahamin fuhr diese Busroute seit 27 Jahren und behandelte seine Fahrgäste wie Freunde – viele waren es auch. Hatte einer einmal nicht genug Geld für den Fahrpreis bei sich, legte Rahamin (dessen Name im Hebräischen «Mitleid» bedeutet) es für ihn aus. Wenn Leute auf die Haltestelle zugerannt kamen, wartete er auf sie. Shiri Nagari verpasste den Bus. Ihre Mutter trat aufs Gaspedal, um ihn an der nächsten Haltestelle einzuholen, damit Shiri nicht zu spät zu der Bank kam, bei der sie einen befristeten Job gefunden hatte. Die 21-Jährige mit dem blonden Zopf, der ihr bis zur Hüfte reichte, war dabei, Geld zusammenzukratzen, um sich die Studiengebühren an der Jerusalemer Hebräischen Universität leisten zu können. Sie hoffte, dort wie ihre Schwester Medizin studieren zu können. Für die Grundschüler war es der letzte Schultag, und die in Äthiopien geborene Christin Galila Bugala konnte ihn kaum erwarten. Die Elfjährige war so populär, dass ihre Klasse sie zur Zeremonienmeisterin für ihren bevorstehenden «Spaßtag» gewählt hatte. Als Shani Avi-Zedek in den Bus stieg, ermahnte ihre Mutter sie, Sonnencreme aufzutragen. «Die Sonne wird mich nicht umbringen», antwortete die 15-Jährige, die sich auf den Ausflug ihrer neunten Klasse ins Freibad freute. Vor ihr lagen geschäftige Tage: Nachhilfestunden für das Kind eines versehrten Kriegsveteranen, ein Auftritt bei einer Tanzveranstaltung, dann der Flug nach Berlin im Rahmen eines israelisch-deutschen Jugendaustauschs. Raffi Berger gab seiner Frau Orit einen Abschiedskuss und machte sich auf, den rappelvollen Bus zu erwischen, der ihn zu seinem Arbeitsplatz in einem Chemielabor der Hebräischen Universität bringen sollte. Orit war froh, dass Raffi, der Reservist war, wohlbehalten von einem Kampfeinsatz zurückgekehrt war. Er hatte an einer militärischen Operation in der West Bank teilgenommen, die dem Ziel diente, auf ihren Einsatz wartende Selbstmordattentäter abzufangen und Sprengstofflabore zu zerstören. Als das jung verheiratete Paar in seine erste gemeinsame Wohnung zog, hatte Raffis Bruder, ein Statistiker, ihm vorgeschlagen, einen Kredit aufzunehmen und ein Auto zu kaufen. «Machst du Witze?», hatte Raffi ihn angefeixt. «Ein Student in Jerusalem hat ein sichereres Leben als ein Soldat in Jenin.» Immerhin war Raffi ein vorsichtiger Buspassagier, der die einschlägigen Statistiken kannte: Die sichersten Plätze sind die ganz vorne beim Fahrer. Um 7.50 Uhr bestieg Ayman Gazi, Student an der Pädagogischen Hochschule, an der Raffis Vater Mathematik lehrt, den Bus der Linie 32A in Begleitung einiger arabischer Israelis, die Kommilitonen von ihm waren. Der Letzte, der zustieg, war ein junger Mann mit Brille und rotem Hemd. Sich anschickend, beim Fahrer ein Ticket zu kaufen, machte er zwei Schritte vorwärts. Eine Sekunde später schoss mit ohrenbetäubendem Knall eine große Feuerkugel nach oben, und angesengte Schultaschen und Menschenbeine flogen durch die Luft. Dann kehrte eine unheimliche Stille ein, später waren Schreie zu hören. Die Alarmsirenen von Dutzenden Rettungsfahrzeugen konnten das Stöhnen der Verletzten nicht übertönen. Rahamin saß noch auf dem Fahrersitz, seine leblosen Hände ans Lenkrad geklammert. Blut sickerte über die Einstiegsstufen. Die Explosion hatte die vordere Hälfte des Busses zerstört. Die 22-Kilo-Bombe des Palästinensers tötete Ayman, Raffi, Shani, Galila, Shiri und vierzehn weitere Fahrgäste. Der Bus war nur noch ein geschwärztes Metallskelett, so verbogen, dass es den Rettungsmannschaften schwer fiel, die Leichen aus dem Wrack zu bergen. Sie betteten sie in schwarze Plastikbeutel, die sie auf dem Gehweg ablegten. Daneben lagen herrenlose Mobiltelefone, die klingelten und klingelten. Zu dem grausigen Hagel, den die Bombe an Bord des Busses der Linie 32A versprühte, gehörten mit tödlichem Rattengift präparierte Nägel und Schrauben, die sich in Gehirne, Lungen und Augen bohrten. Als die nur allzu erfahrenen Sanitäter, zu deren Ausrüstung eine Pistole am Gürtel gehört, die 74 Verletzten in Rettungswagen verfrachteten, wussten sie nicht, welche unter ihnen Juden, welche Araber waren. Rettungskräfte machen keine Unterschiede. Auf der Wöchnerinnen- und auf der Intensivstation liegen arabische und jüdische Patienten Bett an Bett. Auch in der Leichenhalle liegen sie nebeneinander. Raffi Bergers Frau, Musiklehrerin an einer Grundschule, fuhr mit einem späteren Bus. Der bog plötzlich ab und nahm eine andere Route. Die Straße ist gesperrt, verkündete der Busfahrer, wegen eines Terroranschlags. Orit wählte Raffis Handynummer. Keine Antwort. Sie wählte wieder. Und wieder. Sie rief in seinem Labor an der Hebräischen Universität an. Er war noch nicht eingetroffen. Sie rief seine Eltern an. Die klapperten die Krankenhäuser ab. Als es Mittag war, entschlossen sie sich, die Fahrt zu machen, vor der es jedem Israeli graut – zum gerichtsmedizinischen Institut in Tel Aviv. Die Leichen waren so schlimm zugerichtet, dass es unmöglich war, sie zu identifizieren. Man zeigte den Bergers verkohlte Schuhe und Eheringe. Eine Schwester nahm Blutproben von Raffis Mutter und Vater. Ihre DNA stimmte mit der einer Gewebeprobe überein. Raffi hatte geglaubt, als Student in Jerusalem, auf einem der Vordersitze eines Linienbusses, sicherer zu sein als bei der Fahndung nach Terroristen im Raum Jenin; sein Schicksal wollte es anders. Der Mann im roten Hemd, der sein Fahrgeld nicht bezahlt hatte, war Muhammad al-Ghoul, Student der islamischen Jurisprudenz an der Al-Najah-Universität in Nablus, wo Chemiestudenten bei der Produktion von Sprengstoff ertappt wurden und Transparente mit der Aufschrift «Israel hat Atombomben, wir haben menschliche Bomben» auftauchten. An dieser Universität haben Werber der Hamas (das arabische Wort steht für «Feuereifer» oder «Tapferkeit» und ist zugleich ein Akronym für «islamische Widerstandsbewegung») eine Reihe von Studenten rekrutiert, die bereit sind, im Kampf für einen islamischen Staat zu sterben, der das gesamte Gebiet des heutigen Staates Israel einschließen würde. Muhammad hinterließ seiner Familie einen Abschiedsgruß: «Wie schön es ist, zu töten und getötet zu werden… für das Leben der kommenden Generation.» Seinen Angehörigen, die in einem Flüchtlingslager bei Nablus leben, überbrachten Besucher Kondolenzbotschaften und Glückwünsche. «Mein Bruder ist ein Held, ich bin nicht traurig», sagte seine Schwester. «Ich bin sehr glücklich, dass er ein Märtyrer ist», setzte sein Vater hinzu. «Unsere Söhne wollen für unser Land sterben, damit wir es zurückbekommen. » Bis 2003 erhielt die Familie eines Selbstmordattentäters mindestens 250 000 Dollar aus dem Irak, dazu Prämien von Privatleuten aus Saudi-Arabien. Die Familie eines Palästinensers, der beim Versuch, einen Terroranschlag zu verüben, von Spezialisten der Israeli Defense Forces (IDF) liquidiert wurde, bekam 10 000 Dollar. Zum Zeitpunkt von Muhammads Tod befürwortete, wie Umfragen zeigten, eine Mehrheit der Palästinenser Selbstmordanschläge und sprach sich für die Vernichtung Israels aus. Muhammad entsprach dem Anforderungsprofil für den «idealtypischen » Märtyrer: Er war überzeugter Muslim, unverheiratet, männlich und Anfang zwanzig. Im Verlauf der zweiten Intifada sind jedoch neue Typen von Selbstmordattentätern auf den Plan getreten: Nunmehr handelte es sich um junge Frauen, verheiratete Männer und Schüler. Terroristen können überall auftauchen und äußerlich durch nichts auffallen. Sie sind in zahlreichen Verkleidungen aufgetreten: in gestohlenen israelischen Uniformen, als orthodoxe Rabbiner mit Vollbart, einmal sogar als Punker mit blond gefärbtem Haar. Die erste Selbstmordbomberin brauchte sich noch nicht zu verkleiden. Die hübsche 27-Jährige sah wie eine typische Israelin aus. Kurz nachdem ihr Cousin sich von ihr scheiden ließ, weil sie unfruchtbar war, spazierte die Frau, die als Sanitäterin für den palästinensischen Roten Halbmond arbeitete, durch die Innenstadt von Jerusalem und sprengte sich in die Luft. Ein zum Sterben entschlossener Terrorist ist kaum zu stoppen. Am 27. Juni 2002, eine gute Woche nachdem Muhammad al-Ghoul den Bus der Linie 32A gesprengt hatte, strahlte das palästinensische Fernsehen ein «Jungfrauen-Video» aus. Es zeigte einen gut aussehenden Palästinenser, der israelische Soldaten beobachtete. Dann tauchten aus einem Traumnebel wunderschöne Mädchen in wallenden weißen Gewändern auf, die verführerisch lächelten und ihn zu sich winkten. In der nächsten Szene ermordete er die Soldaten. Als er sich zur Flucht wandte, wurde er erschossen. Es folgte ein Schnitt auf eine junge Frau im weißen Kleid, die ihn im Paradies willkommen hieß. In der letzten Einstellung dieses Werbevideos waren Dutzende von Jungfrauen zu sehen, die den lächelnden Märtyrer zärtlich liebkosten. (Muslimen, die bei ihrem Selbstmord möglichst viele Juden mit in den Tod reißen, wird der Ehrentitel eines Shahid verliehen, eines «Märtyrers des islamischen Dschihad».) Obwohl der Koran die Selbsttötung ausdrücklich verurteilt, gilt der Dschihad, der heilige Krieg, offensichtlich als eine hinreichende Rechtfertigung für die Hingabe des eigenen Lebens. Schon der erste Blutstropfen, den ein Märtyrer verliert, berechtigt ihn zum Eingang ins Paradies, in dem, wie der Koran verheißt, «72 Jungfrauen jeden Märtyrer erwarten.… Die Frauen haben Rehaugen. Sie sind wie kostbare Juwelen. Sie sind so weiß,… und wenn sie Wasser trinken, kannst du sehen, wie das Wasser durch ihre Kehle fließt.» Dr. Adel Sadeq, Vorsitzender der Arabischen Psychiatrischen Vereinigung, hat über Selbstmordattentäter dies zu sagen: «Als professioneller Psychiater behaupte ich, der Höhepunkt des Glücksgefühls wird am Ende des Countdowns erreicht: zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Wenn der Märtyrer bei ‹eins› anlangt und explodiert, hat er das Gefühl zu fliegen, weil er mit Bestimmtheit weiß, dass er nicht stirbt. Es ist ein Übergang in eine andere, schönere Welt. In der westlichen Welt opfert niemand sein Leben für das Vaterland. Jeder springt als Erster über Bord, wenn sein Vaterland untergeht. In unserer Kultur ist das anders.… Das ist die einzige arabische Waffe, die existiert, und jeder, der etwas anderes behauptet, ist ein Verschwörer.» Yael Shafir wachte mit einem euphorischen Gefühl auf. Durch das Fenster ihres Schlafzimmers sah sie draußen in der judäischen Wüste goldenes und rosafarbenes Licht flirren. Aus der Ferne grüßten die Hebräische Universität und das Hadassah-Krankenhaus auf dem Scopus-Berg. An der Schranktür hing ihr Designer-Hochzeitskleid aus weißer Seide. Gleich am Abend ihrer ersten Begegnung in einer Jerusalemer Diskothek hatte sie gewusst, dass er derjenige war. Obwohl sie schon seit drei Jahren zusammenlebten, hatte sich Yael entschlossen, die Nacht vor der Hochzeit in ihrem alten Schlafzimmer im Haus ihrer Eltern in dem vornehmen Jerusalemer Wohnviertel French Hill zu verbringen. Verschlafen schlurfte sie in die Küche, wo Nescafé bereitstand, doch dann war sie mit einem Schlag hellwach. Ihre Eltern und ihr jüngerer Bruder Yair lauschten gebannt einer Eilmeldung im Radio: Selbstmordattentäter in einem Bus der Linie 32A. «Mein erster Gedanke war: ‹Wen kenne ich, der mit diesem Bus fährt? Wer wohnt in der Gegend? Irgendeines meiner Kinder?›», erinnert sich Yael, die als Spieltherapeutin und Reflexologin mit schwer behinderten Kindern arbeitet. «Ich hörte die Einzelheiten, dann hielt ich es nicht mehr aus. Nicht an meinem Hochzeitstag. Ich hatte nur noch den einen Gedanken: ‹Ein paar Tage hatten wir Ruhe. Warum nicht noch eine Weile?›» Ihre Mutter Dorit suchte einen anderen Sender. Überall wurde schwermütige hebräische Musik gespielt. Dieselben melancholischen Melodien nach jedem Terroranschlag. In Jerusalem herrschte Alarmstufe Eins. Mindestens vier Selbstmordattentäter waren unterwegs. Wie viele der 300 Hochzeitsgäste werden absagen? Viele, fürchtete Yael. Schon vor Monaten hatte eine Tante aus Tel Aviv angerufen und gesagt, sie habe Angst, nach Jerusalem zu kommen. Eine Cousine aus Safed hatte mitgeteilt, sie sei mit den Nerven ziemlich fertig und habe Angst davor, auch nur in die Nähe eines Busses zu kommen. Die Worte «besondere Sicherheitsvorkehrungen »auf Yaels Hochzeitseinladung waren nicht prophetisch gemeint, sie gehören in Israel zur Normalität. In den Gelben Seiten bieten zahlreiche Firmen Sicherheitspersonal an, bewaffnet mit Maschinenpistolen oder Handfeuerwaffen. «Alle ordern für jede Art von Feier bewaffnete Sicherheitsleute», sagte Dorit feierlich. «Wir haben acht angefordert.» In der Jerusalemer Innenstadt herrschte eine trostlose Stimmung. Als Dorit, die als Kuratorin im Israelischen Museum arbeitet, ihre Tochter zum Frisör chauffierte, registrierte sie die zum Gedenken an die getöteten Busfahrgäste auf Halbmast gesetzten Flaggen. Während die Haarstylistin weiße Jasminblüten in Yaels hüftlanges brünettes Haar flocht, erbot sich Dorit, etwas zum Mittagessen zu besorgen. «Als ich wegging, sagte sie: ‹Mama, bitte sei vorsichtig. Schau dich um. Und bleibe nicht zu lang aus. Ich liebe dich.› So weit ist es gekommen. Bevor man ein Sandwich kaufen geht, bekommt man von seinem Kind noch eine Liebeserklärung mit auf den Weg, für den Fall, dass man nicht zurückkommt.» Als Dorit einen Autoaufkleber mit der Aufschrift «Lebe den Augenblick» sah, erinnerte sie sich daran, dass Yael und ihr Verlobter in dem Jerusalemer In-Lokal «Café Augenblick» gesessen hatten, einen Abend bevor ein Selbstmordattentäter dort siebzehn junge Leben ausgelöscht hatte. Unter den Opfern war ein anderes verlobtes Paar gewesen. Die Fernsehnachrichten hatten die Mutter am Grab ihrer Tochter gezeigt. Anstelle eines Kranzes hatte sie einen roten Brautstrauß niedergelegt. Yaels Hochzeitsfeier fand in Ein Hemed statt, einem schönen Nationalpark am Stadtrand von Jerusalem, dem die Kreuzfahrer wegen seiner sprudelnden Bäche den Namen Aqua Bella gegeben hatten. Die ankommenden Gäste wurden von den Sicherheitsleuten durchsucht: Jeder Kofferraum wurde geöffnet, jeder Behälter, jede Handtasche. Die Wachen inspizierten Brieftaschen, Lippenstifte, Parfümfläschchen. Als Israeli fügt man sich diesem vertrauten Ritual beim Betreten öffentlicher Orte; man empfindet Sicherheitsleute nicht mehr als notwendiges Übel, sondern ist ihnen aufrichtig dankbar. Im Schatten von Mauerruinen aus Kreuzzugszeiten gingen die Gäste über eine Brücke, die einen Bach querte, und landeten nach kurzer Wegstrecke in einem natürlichen Amphitheater. Von ihren Plätzen aus blickten sie auf eine aus Stein gemauerte Bühne hinab. Als Yael hereinkam, ertönte aus den Lautsprechern «You’ve Made Me So Very Happy» von Blood, Sweat and Tears. Als sie die letzten Schritte aus ihrer Vergangenheit in ihre Zukunft tat und sich der Huppa näherte, dem Hochzeitsbaldachin, warf sie nervöse Blicke ins weite Rund, in der bangen Hoffnung, dass die meisten der geladenen Gäste gekommen waren. Und ob: Verwandte und Freunde waren aus Galiläa, von den Golan-Höhen, aus dem Negev herbeigeströmt, über 350 Gäste, mehr sogar, als sie eingeladen hatten. Sie trotzten der Alarmstufe Eins und demonstrierten ihre Entschlossenheit, sich nicht von Terroristen einschüchtern zu lassen. Diese Trotzhaltung hat den Israelis geholfen, in der gefährlichsten Umgebung der Welt ein normales Leben zu führen. Die Familie war hocherfreut und ließ zusätzliche Tische für die überzähligen Gäste aufstellen. Yaels Bräutigam war Schlagzeuglehrer und spielte Bass in einer Band; deshalb waren unter den Gästen viele Musiker. Dennoch hatte das Brautpaar einen Diskjockey engagiert, denn die Gäste sollten nicht Musik machen, sondern feiern. Der DJ legte israelischen Ethnorock auf, aber auch amerikanischen und britischen Funk und Punk sowie Platten aus Kuba und Brasilien mit Salsa-Groove. «Alles tanzte, sogar mein 81-jähriger Großvater. Wir feierten und tranken fast bis zum Morgengrauen. Israelis können Feste feiern, sie wissen das Leben beim Schopf zu packen.» Nachdenklich werdend fügte Yael hinzu: «Wir alle wissen, was hier los ist, aber manchmal tun wir unser Möglichstes, um uns von der Wirklichkeit abzumelden.» «Es ist eine Mitzwa [ein Gebot], mit Braut und Bräutigam am glücklichsten Tag ihres Lebens ausgelassen zu feiern, aber um mich herum war eine sehr dunkle Wolke», räumt Eli Ben-Eliezar ein, Abteilungsleiter bei der Jewish Agency, die Einwanderern und solchen, die es werden wollen, Hilfe leistet. Drei Stunden vor Beginn dieser Hochzeitsfeier hatte Eli noch bei einem Begräbnis Tränen vergossen. Sein Vetter hatte in dem Bus der Linie 32A gesessen. Die jüdische Tradition will es, dass Tote so schnell wir möglich begraben werden, damit ihre Seele in den Himmel aufsteigen kann – die Seele Rahamins hatte ihren Aufstieg zum Himmel nur neun Stunden nach seiner letzten Busfahrt begonnen. Eine riesige Menschenmenge machte seiner schreckgelähmten Witwe und seinen vier Kindern ihre Aufwartung. Sie gehören einer alteingesessenen, angesehenen Jerusalemer Familie an, kurdische Juden ursprünglich, aus dem Irak zugewandert, Inhaber eines Verkaufsstands für Oliven und Eingelegtes auf dem belebten Mahane-Yehuda-Markt, einem beliebten Terroristenziel. Unter den Trauernden waren etliche seiner langjährigen Fahrgäste und Busfahrerkollegen in blauen Hemden, die darauf geschult werden, Selbstmordattentäter zu erkennen. «Warum Rahamin? Der liebevollste, besorgteste Vater?», fragt Eli untröstlich. «Er machte Pläne für die Bar Mitzwa seines Sohnes an der Kotel [der Westmauer, der heiligsten Stätte des Judentums]. Als Geschenk besorgte er Eintrittskarten für EuroDisney bei Paris.» Noch einige weitere Bestattungen fanden an diesem Nachmittag auf dem felsigen Hügelfriedhof statt, alles Fahrgäste des Busses 32A. Es war nicht das erste Mal, dass Eli an ein und demselben Tag ein Begräbnis und eine Hochzeit besuchte. «Wenigstens blieben mir bis zu Yaels Hochzeit fast drei Stunden. Das letzte Mal hatte ich weniger als eine Stunde. Ich wünschte meinem besten Freund mit einem Kuss Massel tov, konnte aber nur eine Viertelstunde auf seiner Hochzeit bleiben, dann musste ich mit Vollgas zu einer für 13 Uhr angesetzten Beerdigung eilen. Der Junge war erst achtzehn, ein paar Monate jünger als sein Mörder.» Bevor Muhammad Farhat zu seiner mörderischen Mission aufgebrochen war, hatte seine Mutter ihm einen Kebab und seinen Lieblings-Gurkensalat gemacht. Er hatte ihr erzählt, dass er von seiner Belohnung geträumt hatte: von den Jungfrauen, die ihn im Paradies erwarteten. Mariam Farhat hatte ihren Sohn in seinem Vorhaben bestärkt. Wenig später hatte sie erfahren, dass er fünf Teenager mit in den Tod gerissen und weitere 23 jüdische Fahrgäste verwundet hatte. «Erst wenn ich weiß, dass alle Juden in Palästina tot sind, werde ich zufrieden sein», sagte sie in die Kameras des TV-Senders «Al-Jazeera »: «Wir lieben das Märtyrerwesen genau so, wie Israel das surreale Leben liebt, das es führt.» Die Hamas brachte das Abschiedsvideo massenweise unter die Leute, das zeigt, wie Frau Farhat ihren Sohn küsst und sagt, sie wünsche, sie hätte «hundert Söhne wie ihn». Ihr Mann, Polizist in Diensten der Palästinensischen Autonomiebehörde in Gaza, wird dafür bezahlt, Terroristen und solche, die es werden wollen, zu stoppen. Aus dem Englischen von Karl Heinz Siber S.14 - 22; Copyright Verlag C.H.Beck oHG |
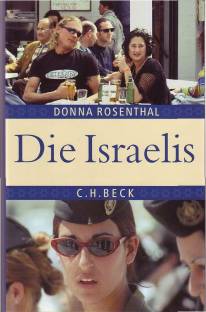
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen