|
|
|
Umschlagtext
NACHWORT
ZWEI LÄNDER, ZWEI KONFESSIONEN Die vorliegende Übersetzung entstand im Zeichen der ökumenischen Bewegung in dem Bewußtsein: »Mehr als einzelne gemeinsame Aktionen führt gemeinsames Hören auf das Wort der Schrift dazu, daß die getrennten Kirchen aufeinander zugehen«, so der damalige Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Helmut Claß, in einem Brief von 1979 an den damaligen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Joseph Kardinal Höffner. Er bezog sich hinsichtlich der »Einheitsübersetzung« auf die »Tatsache, daß katholische und evangelische Christen nunmehr die Psalmen und ein Neues Testament besitzen, die Exegeten beider Kirchen in offiziellem Auftrag übersetzt haben«. Die Neuausgabe zeigt Werke der niederländischen Malerei. Sie stammen aus einer Epoche der Kirchen-, Kultur- und Kunstgeschichte, in der sich Kirchen als getrennte Glaubensgemeinschaften bildeten und voneinander entfernten. Insofern könnte ein Gegensatz, zumindest ein Spannungsverhältnis zwischen dem Text und seiner Begleitung durch Bilder bestehen. Oder bedient sich die bildende Kunst bei aller Bindung an die eigene Zeit einer Bildsprache, die seit jeher zur Überwindung von Parteigrenzen aller Art befähigt? Jene Epoche des politisch in Anspruch genommenen Kon-fessionalismus trennte im Nordwesten auf kleinem Raum zwei Länder: die nördlichen und die südlichen Niederlande. Nach einem gemeinsamen Aufstand (1568) gegen die spanische Unterdrückung vereinigten sich die protestantischen Provinzen des Nordens 1581 zur Utrechter Union, sagten sich von Spanien und dem Hause Habsburg los und gründeten die Republik der Vereinigten Niederlande. Dazu gehörten die Provinz Holland und die Städte Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Leiden und Utrecht. Die südlichen Provinzen mit Flandern und den Städten Antwerpen, Brügge, Brüssel und Gent vereinigten sich zur Union von Arras, schlossen mit Spanien den Frieden von Arras und standen weiterhin unter spanischer Herrschaft, die ein Generalstatthalter in Brüssel ausübte. Religiöse Unduldsamkeit der Calvinisten im Norden gehörte zu den Gründen für die Spaltung der Freiheitsbewegung. Seit jener Spaltung zwischen dem protestantischen Norden und dem spanischen, katholischen Süden der Niederlande unterscheiden sich die holländische Kunst und die flämische Kunst. Ihre Repräsentanten in der Malerei des Barock sind Rembrandt in Amsterdam und Rubens in Antwerpen. DIE VORGESCHICHTE Mit 65 Werken ist Rembrandt der dominierende Künstler im Bildprogramm der vorliegenden Neuausgabe der Bibel. Ihm folgt Rubens mit 19 Gemälden. Hinzu kommen 45 Künstler, die einerseits als Zeitgenossen die Vielgestalt der holländischen und der flämischen Malerei der Rembrandt-Zeit repräsentieren, andererseits die Vorgeschichte seit dem Ende der altniederländischen Kunst. Einen Überblick über nahezu zwei Jahrhunderte bietet die tabellarische »Chronologie der Werke«. Diese Zeittafel beginnt mit dem Fragment eines Altarbilds des aus Deutschland stammenden und ab 1465 in Brügge tätigen Hans Memling (S. 614/615). Seine Ausbildung erhielt er in Brüssel in der Werkstatt des Regier van der Weyden und somit in der Tradition des Jan van Eyck, dessen Schaffen im Übergang von der Spätgotik zur Erührenaissance der niederländischen Malerei europäische Bedeutung gab; insbesondere in italienischen Kunstzentren (Florenz, Neapel), die in enger ökonomischer und kultureller Verbindung standen, fand die niederländische Malerei des 15.Jahrhunderts außerordentliche Wertschätzung. Umgekehrt gewann in der ersten Hälfte des 16.Jahrhunderts Italien die führende Rolle in der europäischen Kunst, verbunden mit dem Vorrang von Rom gegenüber Florenz: Die niederländischen Romanisten schulten sich als »Romfahrer« an den Errungenschaften der italienischen Renaissance, zu denen der Gleichrang christlicher and antiker Themen gehörte. Ein Beispiel in der Berliner Gemäldegalerie sind zwei Aktgemälde des Romanisten Jan Gossaert: »Neptun und Am-phitrite« (1516) für das Schloß Souburgbei Middelburg des Philipp von Burgund (1464-1424), den Gossaert 1508 nach Rom begleitet hatte, und »Der Sündenfall« (um 1525, S. 15). Die herausragende Persönlichkeit um die Mitte des 16. Jahrhunderts ist Pieter Bruegel d.Ä., Stammvater einer Künstlerfamilie. Zunächst in Antwerpen tätig, hielt er sich 1553 in Rom auf und übersiedelte 1563 nach Brüssel. Sein Gesamtwerk umfaßt Themen der Bibel, Landschaften im Wechsel der Jahreszeiten, Motive des alltäglichen Lebens unter dem Gesichtspunkt sprichwörtlich formulierter Lebenserfahrungen sowie Vorstufen der Genremalerei aus dem bäuerlichen Bereich, das ihm den Beinamen »Bauern-Bruegel« eintrug. Pieters zweiter Sohn, Jan Brueghel d.Ä., gehörte als »Blu-men-Brueghel« zu den Spezialisten, die Rubens bei der Darstellung von Girlanden heranzog (S. 657). Doch war Jan kein »Fachmaler« im engeren Sinne, sondern widmete sich auch der Landschaft und der szenischen Darstellung biblischer Themen; deren Gleichrang mit antiken Themen verdeutlichen zwei Werke in der Alten Pinakothek München, die zugleich Jans Vorliebe für das »Nachtstück« erkennen lassen: »Der Brand von Troja« (mit dem Motiv der Engelsburg in Rom, die er während seiner Italienreise 1590-96 kennengelernt hatte) und »Sodom und Gomorra« (S. 24). In der Tradition seines Vaters schuf er Volksszenen vom »Römischen Karneval« bis zum »Großen Fischmarkt«. Der Gruppe der niederländischen Romanisten der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts entspricht in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts die Gruppe der holländischen Caravaggisten. Sie waren vor allem in Utrecht tätig, nachdem sie in Rom Werke von Caravaggio studiert hatten. Hauptvertreter des Utrechter Caravaggismus sind Hendrick ter Brugghen (S. 39,45) und Gerard van Honthorst (S. 1105, 1128), beide Schüler von Abraham Bloemaert. Zu den Schülern von Honthorst gehört Mat-teus Stom (S. 1030), der von 1630 bis zu seinem Tod (nach 1641) in Rom und Neapel tätig war. Daß Florenz nicht gänzlich im Schatten von Rom stand, zeigt die künstlerische Laufbahn des aus Brügge stammenden Pieter de Witte, gen. Peter Candid (S. 230). Mit 20 Jahren wurde er in Florenz Schüler von Giorgio Vasari und beteiligte sich an der Ausmalung der Domkuppel, kehrte allerdings in den Norden zurück und stand von 1586 bis zu seinem Tod 1626 in München in herzoglichen Diensten. Zu den späten »Romfahrern« gehört der vermutlich aus Haarlem stammende Jacob Pynas (S. 884/885), der nach seiner Rückkehr in Delft sowie vorübergehend in Den Haag tätig wurde. Für ihn und verwandte Maler dramatischer biblischer Szenen wurde die Bezeichnung als »Prärembrandtisten« geprägt. Allerdings ist die Wahl mythologischer Szenen mit biblischem oder antikem Inhalt in der Tradition des Gleichrangs beider Kulturschichten nur eines der wesentlichen Elemente der niederländischen, d.h. der holländischen wie auch flämischen Kunst »vor Rembrandt«. Von gleicher Bedeutung sind die Erhebung der alltäglichen Erfahrungswelt zum Gegenstand der Kunst und der Caravaggismus mit der revolutionären Verbindung physiognomischer und gestischer Dramatik und Ausdruckskraft mit einer aus dem »Nachtstück« entwickelten Steigerung von Licht und Schatten. REMBRANDT UND RUBENS Peter Paul Rubens wurde 1577 in Siegen in Westfalen geboren. Sein Vater war ein aus Antwerpen emigrierter Jurist, nach dessen Tod 1589 die Familie in die flämische Metropole zurückkehrte. Hier erhielt Rubens eine künstlerische Ausbildung und wurde bereits 1598 als Freimeister, d.h. als selbständiger Künstler-Unternehmer, in die Lukasgilde aufgenommen. Von 1600 bis 1608 studierte und arbeitete Rubens in Italien. Sein Auftraggeber wurde Herzog Vincenzo Gonzaga in Mantua; die- ser schickte ihn 1603/04 in diplomatischer Mission nach Spanien. Seine künstlerischen Studien betrieb Rubens in Genua, Venedig und Rom; hier begegnete er dem antiken Erbe, den Werken der Renaissance (Raffael, Michelangelo) und der jüngsten künstlerischen Erneuerung, die in Rom Caravaggio ausgelöst hatte. Nach Antwerpen zurückgekehrt, heiratete Rubens 1609 Isabella Brant (1591-1626), die Tochter eines Antwerpener Patriziers und Stadtsekretärs. Im selben Jahr wurde Rubens Hofmaler des in Brüssel residierenden Statthalterehepaares, durfte jedoch entgegen der üblichen Residenzpflicht in Antwerpen bleiben. Hier erwarb er 1610 ein Grundstück, auf dem 1617/18 ein geräumiges Wohnhaus mit Atelier entstand, Stätte der bald umfangreichen Rubens-Werkstatt für eine wachsende Zahl kirchlicher und profaner Aufträge. Zu den engsten Mitarbeitern zählte ab 1618 Anthonis van Dyck, der 1615 eine eigene Werkstatt in Antwerpen eröffnet hatte. Der Hofdienst als Maler war mit diplomatischen Aufträgen verbunden; sie führten Rubens 1628 erneut nach Spanien an den Hof Philipps IV. und 1629/30 an den Hof Karls I. nach London. Aufgrund der Verbindungen zum gleichfalls katholischen Hof in Paris war 1622-25 ein monumentaler zeitgeschichtlichallegorischer Gemäldezyklus über und im Auftrag von Maria de' Medici, der Witwe Heinrichs IV., entstanden. Zu dieser Zeit ging Rembrandt, Sohn des Müllers Härmen van Rijn, in seiner Heimatstadt Leiden eine Ateliergemeinschaft mit dem Maler Jan Lievens ein. Sein frühestes datiertes Gemälde ist das neutestamentliche Historienbild »Die Steinigung des Stephanus« (1625, S. 1122); einem der Zuschauer gibt Rembrandt die eigenen Gesichtszüge auf der Grundlage phy-siognomischer Ausdrucksstudien. In diese Zeit fällt eine halbjährige Lehrzeit bei dem Historienmaler Pieter Lastman in Amsterdam. 1628 wird in Leiden der 14jährige Gerrit Dou der erste Schüler des 22jährigen Rembrandt. Dieser übersiedelt Ende 1631 nach Amsterdam und wird Partner des Kunsthändlers Hendrick van Uylenburgh (1587-1661), an dessen Geschäft eine Akademie angeschlossen ist. Hier unterrichtet Rembrandt und festigt zugleich sein Ansehen als Porträtist in Kreisen des Patriziats. 1634 wird er Bürger von Amsterdam und Mitglied der Lukasgilde; solchermaßen in gesicherten Verhältnissen lebend, heiratete er im selben Jahr die Großnichte von Van Uylenburgh, Saskia van Uylenburgh (1612-1642). 1636 erwarb Frederik Hendrik von Oranien, Statthalter der nördlichen Niederlande mit Sitz in Den Haag, die »Kreuzaufrichtung« (S. 1007) und die »Kreuzabnahme (S.1074). Bis 1646 folgten »Grablegung« (S. 1033), »Auferstehung« (S. 1009) und »Himmelfahrt« (S. 1115); diesen Passionszyklus ergänzten die »Anbetung der Hirten« (S. 1039) sowie eine nur als Kopie (Braunschweig) überlieferte »Beschneidung Jesu«. Eine weitere Fortführung verhinderte wohl der Tod des Statthalters 1647. Als Rubens, der seit 1630 in zweiter Ehe mit Helene Four-ment verheiratet war und 1635 den Landsitz Het Steen erworben hatte, 1640 im Alter von 63 Jahren in Antwerpen starb, befand sich Rembrandt in Amsterdam auf dem Höhepunkt seiner mit sozialem Prestige verbundenen Karriere als Maler, Grafiker sowie Sammler von Kunst und Antiquitäten. Die Büchsen-schützen-Kompanie von Amsterdam erteilte ihm den Auftrag eines Gruppenporträts für den großen Saal des neuen An-baus des Gildehauses »Kloveniersdoelen«. 1642, als diese sog. »Nachtwache« vollendet wurde und teilweise auf Unzufriedenheit der Auftraggeber stieß, starb Saskia nach der Geburt des Sohnes Titus. Die Rembrandt-Legende betrachtet dieses Jahr als Wendepunkt im Verlauf einer Tragödie bis hin zur Katharsis einer Verdüsterung der äußeren Lebensverhältnisse bei zunehmender Verarmung und einer spirituellen Erhellung im künstlerischen Spätwerk. Unbestreitbar sind seine ökonomische Schwierigkeiten mit Zwangsversteigerung von Haus und Kunstbesitz und die Vereinsamung durch den Tod seiner Lebensgefährtin Hendrickje Stoffels (1663) und seines Sohnes Titus (1668). Andererseits bezeugen schriftliche Quellen und der Besitz prominenter Sammler den europaweiten Ruhm des »pittore famoso«, den z. B. Cosimo III. de' Medici 1669 in Amsterdam besucht und der dabei ein soeben vollendetes Selbstbildnis erworben hat (heute Florenz, Uffizien). Im selben Jahr starb Rembrandt in Amsterdam. Daß Rubens und Rembrandt jeweils 63 Jahre alt geworden sind, gehört ebenso zu den biografischen Gemeinsamkeiten wie der frühe Verlust der ersten Ehefrau. Gemeinsam sind Themen wie Batseba mit der zweiten Ehefrau bzw. der Lebens- gefährtin als Modell (S. 290 und 573) oder Darstellungen zur Passion Jesu; Rembrandts »Kreuzabnahme« (S. 1074) ist sogar ein kompositorisches Pendant zu Rubens' Gemälde (S. 1109). Beide Maler haben sich der Weihnachtsgeschichte gewidmet. Doch gerade bei diesem Thema zeigen sich charakteristische Unterschiede, ja Gegensätze. Während Rubens die höfische Szene der »Anbetung der Könige« inszeniert (S. 969), besitzt Rembrandts »Anbetung der Hirten« (S. 1039) den Charakter einer Szene aus dem Leben des einfachen Volkes, mit Gestalten, die teils neugierig, teils skeptisch in Augenschein nehmen, was ihnen der Engel verkündet hat. Ein unüberbrückbarer Gegensatz trennt jeweilige Spätwerke wie den »Betlehemitischen Kindermord« (S. 796/797) und die »Heimkehr des verlorenen Sohnes« (S. 1062): höchste Steigerung der tragischen Dramatik äußerer Ereignisse bei Rubens; die Befriedung eines Exzesses in der seelischen Einkehr bei Rembrandt. Künstlerisch ist dies ein Gegensatz zwischen Errungenschaften des Barock als Erweiterung der Gestaltungsmittel mit dem Ziel überwältigender Emotionen einerseits und der gleichfalls barocken Abstraktion sinnlicher Wahrnehmung von Räumlichkeit, physischer Körperlichkeit und Dynamik, farblicher Brillanz und suggestivem Helldunkel zugunsten einer gleichsam verinnerlichten Sinnlichkeit. Sie reicht bei Rembrandt bis zu einer Form der Entmaterialisierung; an die Stelle der frühbarocken Helldunkel-Kontraste, die Himmlisches und Irdisches symbolisieren, tritt das Licht als ahnungsvolle Verheißung, die im Gegenwärtigen und Alltäglichen aufleuchtet. Ohne diese Gegenüberstellung mit den religiösen Strömungen und konfessionellen Parteigrenzen des 17. Jahrhunderts in Deckung bringen zu wollen, erscheint es als hilfreich, die jeweilige Nähe der »Bildsprache« von Rubens und Rembrandt zu katholischen und protestantischen Deutungen und Anwendungen der biblischen wie kirchlichen Überlieferung in Beziehung zu setzen. Eine genauere Betrachtung dieser Beziehungen könnte zeigen, daß Rubens und Rembrandt, nicht zuletzt aufgrund ihrer humanistischen Bildung, kritische Distanz gegenüber dem Dogmatismus und rigiden Pragmatismus »ihrer« Konfessionen wahrten. ALTARBILD, ANDACHTSBILD, HISTORIENBILD Konfessionelle Vorgaben unterscheiden die religiöse Malerei von Rubens und Rembrandt allerdings offenkundig unter dem Gesichtspunkt ihrer Funktion: Nur in den katholischen südlichen Niederlanden bestand ein Bedarf an Altargemälden, während die protestantischen nördlichen Niederlande der calvinistischen Ablehnung jeder Gemeinsamkeit mit dem vorreformatorischen »Bilderkult« treu blieben. Rubens' früher Ruhm als Monumentalmaler gründete sich auf Altarbilder wie ein Triptychon, das die Antwerpener Bodenschützen 1610 für ihre Kapelle in der Liebfrauenkathedrale in Auftrag gaben; die Mitteltafel im Format 420 x 310 cm zeigt die »Kreuzabnahme« (S. 1109). Rubens vollendete das Werk 1612 und erhielt zwei Jahre später von Herzog Wolfgang Wilhelm von der Pfalz-Neuburg den Auftrag für das »Große Jüngste Gericht« (S. 1293). Das über 6 m hohe Gemälde entstand für den Hochaltar der Jesuitenkirche in Neuburg an der Donau. Wir wissen, daß Rubens als Künstler auch am Hof von Den Haag geschätzt wurde, und so ist es kein Zufall, daß hier Rembrandts »Kreuzabnahme« aufgrund der kompositorischen Verwandtschaft mit dem Werk in Antwerpen Anerkennung fand, freilich nicht als Altargemälde, sondern als Werk der religiösen Malerei, fern aller liturgischen (gottesdienstlichen) Zusammenhänge. Vielmehr befand sich der sog. »Passionszyklus« im Palais Nordeinde in Den Haag und gelangte, vermutlich aus preußischem Besitz, in die Düsseldorfer Galerie des Kurfürsten Johann Wilhelm (Jan Willem) von der Pfalz. In diese Kunstsammlung kam allerdings auch das »Große Jüngste Gericht«, nachdem es wegen »anstößiger Nuditäten« 1691 vom Hochaltar entfernt worden war. Das Altarbild verwandelte sich in ein religiöses Historienbild und entsprach insofern nachträglich als Museumsstück der gesamten religiösen Historienmalerei Rembrandts, der nie den Auftrag für ein Altarbild erhalten hat. Doch wie steht es mit der Funktion als Andachtsbild? Diese Kategorie bezieht sich im engeren Sinn auf spätmittelalterliche Werke insbesondere der altniederländischen Kunst. Sie zeigen mit Vorliebe Maria mit dem Jesuskind und die Bewei- nung Jesu (Pietä) in Verbindung mit Bildnissen des Auftraggebers in andächtiger Verehrung. Im weiteren Sinn ist das Andachtsbild keine Sonderform religiöser Malerei, sondern gewinnt seine Bedeutung aufgrund seiner Wirkung. Ein vergleichbares Problem stellt sich beim Begriff der Historienmalerei: Er erscheint als eindeutig bei Darstellungen mythologischer und profangeschichtlicher Themen. Er dient aber auch als Oberbegriff für mythologische Themen der Antike und biblische Szenen, die insofern als »geschichtlich« auf-gefaßt werden. Die Voraussetzung dafür legte im 15. Jahrhundert die »Wiedergeburt der Antike« mit grundlegender Wirkung sowohl für das Zeitalter der Renaissance als auch für das Zeitalter des Barock. Wie beim Andachtsbild ist auch beim Historienbild die jeweilige Wirkung maßgeblich; sie entscheidet darüber, ob etwa eine alttestamentliche Szene als »historisch« oder als »heilsgeschichtlich« verstanden wird, wie dies im Mittelalter die Typologie zum System entwickelt hat. GENREBILD, LANDSCHAFT, STILLEBEN Die ambivalente Wirkung der religiösen Historienmalerei lenkt die Aufmerksamkeit auf drei Gattungen der flämischen und der holländischen Barockmalerei, die ebenfalls im Bildprogramm vertreten sind. Beispiele der Genre- bzw. Sittenmalerei finden sich in den Büchern der Weisheit. Berührungspunkte bestehen im Bereich menschlichen Verhaltens, wobei es nicht überraschen kann, daß im 17. Jahrhundert biblisch überlieferte Maßstäbe assoziiert wurden. Zugleich läßt die Genremalerei die Tendenz zur Emanzipation von biblisch begründeter Morallehre erkennen. Ambivalent, »mehrdeutig« ist beispielsweise Mari-nus van Reymerswaeles »Steuereinnehmer mit seiner Frau« (S. 1253): Das Bild besitzt einerseits die moralisierende Warnung vor der Bindung an materiellen Wohlstand, dessen Vergänglichkeit eine erlöschende Kerze symbolisiert; die nachlässige Geste, mit der die Frau in einem kostbaren Andachtsbuch blättert, während ihr Blick auf die Geldstücke auf dem Tisch gerichtet ist, deren Feingehalt ihr Mann bestimmt, kennzeichnet Oberflächlichkeit. Andererseits handelt es sich um das »Standesporträt« einer Person, die auf dem Schriftstück genannt wird; es handelt sich um einen Brief mit der Adresse: »An den ehrenhaften und weisen, meinen verschwiegenen Freund Boisselaer, Zöllner zu ...« Ein Beispiel für die nachträgliche Verknüpfung eines profanen Sittenbildes mit einem biblischen Text ist »Die Berufung des Matthäus« von Jan Sanders van Hemessen (S. 978/979): Sein »Geldwechsler« von 1536 wurde hundert Jahre später, wohl im Auftrag des bayerischen Kurfürsten Maximilian L, von dessen Hofmaler Georg Vischer rechts durch die Gestalt Jesu ergänzt, der nun den Geldwechsler bzw. Zöllner Matthäus als Jünger beruft. Rembrandts »Geldwechsler« (S. 1047) erhielt seinen biblischen Bezug durch den Titel »Das Gleichnis vom Reichen«. Der bedeutendste Vorläufer der moralisierenden Genremalerei in Flandern ist Pieter Bruegel d. Ä., dessen »Schlaraffenland« (S. 644) mühelos in die Weisheitsliteratur einzuordnen ist. Das Ausbleiben kirchlicher Aufträge trug dazu bei, daß die Landschaftsmalerei im 17. Jahrhundert in den nördlichen Niederlanden eine Blütezeit erlebte. Bei Rembrandt spielt sie zeitweise eine Rolle, doch auch bei Rubens (S. 20). Neben der reinen Landschaft von Spezialisten wie Jacob van Ruisdael entstanden Gemälde, die landschaftliche Motive mehr oder weniger zwingend mit biblischen Szenen bzw. Staffagefiguren verbinden (S. 328/329): Elija trifft die Witwe von Sarepta beim Holzsam-meln, also im Wald. Werfen wir zuletzt einen Blick auf ein Thema, das in gewisser Hinsicht einen Inbegriff der holländischen Malerei bildet: das Stilleben. Es repräsentiert auf eine dem Genrebild vergleichbaren Weise die Ambivalenz von Realismus und Moral mit biblischen Anklängen, beispielsweise an die Warnung vor der Bindurtg (religio) an das Vergängliche. Diesem Zweck dient eine Fülle von offenkundigen und verschlüsselten Symbolen der Vanitas vom Totenkopf über die erloschene Kerze, die Uhr als Meßgerät der verrinnenden Zeit oder Musikinstrumente, deren Töne verklingen, bis zu Insekten, denen köstliche Früchte und prachtvolle Blüten zum Opfer fallen. Ein programmatisches Werk trägt den Titel »Allegorie der Eitelkeit« (S. 642) und zitiert somit das Buch Kohelet (Prediger Salomo), dessen 2. Vers in der Lutherbibel lautet: »Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, es ist alles ganz eitel.« (In der Einheitsübersetzung: »Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet, Windhauch, Windhauch, das ist alles Windhauch«). Doch wäre es zu einfach, in jeglichem Stilleben das zweifellos vielgestaltige Thema der Vergänglichkeit alles Irdischen und somit Zeitlichen zu entschlüsseln. So enthält unser Bildprogramm von Davidsz. de Heem zwar ein »Memento mori« (S. 526), aber auch eine Blumen- und Früchtegirlande um den Kelch als Symbol des alten wie des neuen Bundes (Frontispiz, S. 2). Freilich ist es kein Zufall, daß De Heem zu den Grenzgängern zwischen den nördlichen und den südlichen Niederlanden gehört und in Antwerpen zu prachtvoller Entfaltung seiner malerischen Möglichkeiten gelangte. BILD UND TEXT 1. Im Unterschied zur Buchmalerei geben die 144 Abbildungen »selbständige« Tafelbilder auf Holz oder Leinwand wieder. Unter dem Gesichtspunkt ihrer Beziehung zum biblischen Text lassen sich die folgenden Gruppen unterscheiden. Zunächst dienen sieben Werke wie das einleitende Stilleben (Frontispiz S. 2) oder jenes auf S. 526 am Beginn der Weisheitsbücher und Psalmen dazu, die Gliederung der Bibel zu verdeutlichen: Die fünf Bücher des Mose besitzen als eine Art von Frontispiz Rembrandts Bildnis eines Gelehrten bzw. Rabbiners mit aufgeschlagenem Codex (S. 9.). Die Geschichtsbücher werden durch König Saul und den auf der Harfe spielenden jungen David von Rembrandt eingeleitet (S. 198), die Bücher der Propheten durch Rembrandts Porträt seiner Mutter als Prophetin Hanna (S. 712). Am Beginn der Evangelien stehen Rembrandts Bildnisse Christi und des Evangelisten Matthäus (S. 965 und 966), am Beginn der Offenbarung ein Bildnis des Evangelisten Johannes aus der Rembrandt-Werkstatt (S. 1277). Alle übrigen Werke stehen räumlich in unmittelbarem Zusammenhang mit dem biblischen Text. Als Brücke dient jeweils ein Zitat, das die Bildbetrachtung unterstützt und zur weiterführenden Lektüre anregt. 2. Genau hundert Werke stehen in einer »illustrativen« Beziehung zum Text: Wir können davon ausgehen, daß der Künstler oder sein Auftraggeber den betreffenden Text vor Augen hatte. Allerdings gibt es grundsätzlich keine gleichsam wörtliche Übereinstimmung von Text und Bild; vielmehr ist jede »Illustration« eine Übertragung in das Medium Bild mit dessen Eigengesetzlichkeit und Freiheit, Traditionen und Symbolen, etwa der im Barock zentralen Symbolik von Licht und Finsternis oder der fallenden/steigenden Diagonalen. 3. Als »typologisch« sind Bild-Text-Beziehungen zu verstehen, die sich auf den Zusammenhang zwischen dem Alten und dem Neuen Testament gründen: Neutestamentliche Motive sind in das AT, alttestamentliche in das NT eingeordnet. Zu den vierzehn »typologischen« Beispielen gehört das Bild der »Darbringung im Tempel« (nach Lukas 2,21-40) im 12. Kapitel des Buches Levitikus (S. 110). Zusätzlich enthält das 2. Kapitel des Lukasevangeliums (in dem Levitikus 12 zitiert wird) Rembrandts Darstellung dieses Themas (S. 1041). Der »Turmbau zu Babel« erscheint sowohl im Buch Genesis (S. 22) als auch im Römerbrief (S. 1152/1153) als Beispiel für Handlungsweisen, die Gott erzürnen. Solche Rückbezüge der paulini-schen Briefe auf das Buch Genesis werden auch durch Darstellungen des Sündenfalls, der Verstoßung Hagars, der Opferung Isaaks, der Segnung Jakobs verdeutlicht. »Typologie« bedeutet, daß Personen und Ereignisse des AT theologisch als »Typen« (Präfigurationen) zu »Antitypen« des NT verstanden wurden. Den Ausgangspunkt bildete der Vergleich zwischen Jona und Jesus bei Matthäus (12,40). 4. Zwanzig Abbildungen lassen sich als »moralisierend« bezeichnen, mit mehr oder weniger engem Bezug zum betreffenden biblischen Text. Zu diesen Gruppen gehören die Genrebilder (Sittenbilder), Stilleben, Allegorien. 5. Schließlich sind drei Darstellungen der Beweinung Christi in der Tradition der Pietä in den paulinischen Briefen von Anthonis van Dyck, Rubens und Rembrandt eine der verschiedenen Möglichkeiten, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen flämischer und holländischer Barockmalerei zu entdecken (S. 1183,1212,1293). Christoph Wetzel Inhaltsverzeichnis
Die Heilige Schrift (Einheitsübersetzung)
------------------------------------------------------------------- DIE CHRONOLOGIE DER WERKE 1489 Hans Memling, Segnender Christus mit musizierenden Engeln (S. 614/615) um 1513 Joos van Cleve, Die (kleine) Anbetung der Könige (S. 581) um 1515 Joachim Patinier, Die Taufe Jesu (S. 1012) um 1520 Lucas van Leyden, Lot und seine Töchter (S. 31) um 1520/25 Cornelis Engelbrechtsen, Die Heilung des Aramäers Naaman (S. 340) um 1525 Jan Gossaert, Der Sündenfall (S. 15) um 1528/30 Jan van Scorel, Die Darbringung im Tempel '(S. 110) um 1530 Jan Gossaert, Maria mit dem Kind (S. 721) um 1530/40 Nachfolge des Jan van Scorel, Rut und Noomi auf dem Feld des Boas (S. 248) 1536 und 17. Jh. Jan Sanders van Hemessen, Die Berufung des Matthäus (S. 978/979) 1538 Marinus van Reymerswaele, Ein Steuerein- nehmer mit seiner Frau (S. 1253) 1538 Vincent Sellaer, Lasset die Kindlein zu mir kommen (S. 1024) 1544 Jan Sanders van Hemessen, Die Verspottung Christi (S. 755) um 1550 Jan Sanders van Hemessen, Isaak segnet Jakob (S. 41) 1562 Pieter Bruegel d.Ä., der Selbstmord Sauls (S. 280/281) 1567 Pieter Bruegel d.Ä., Das Schlaraffenland (S. 644) 1568 Pieter Bruegel d.Ä., Der Sturz der Blinden (S. 988) nach 1570 Maerten de Vos, Die Israeliten sammeln das Manna (S. 79) 1593 Abraham Bloemaert, Judit zeigt dem Volk das Haupt des Holofernes (S. 458/459) 1595 Maerten van Valckenborch (I), Der Turmbau zu Babel (S. 22) um 1595/96 Jan Brueghel d. Ä., Jona entsteigt dem Walfisch (S. 926/927) um 1600 Paul Bril, Der Turmbau zu Babel (S. 1152/ 1153) um 1600 Jan Brueghel d. Ä., Sodom und Gomorra (S. 24) 1609 Rubens, Die Verkündigung an Maria (S. 1037) um 1610 Jan Brueghel d. Ä. und Hendrick van Baien, Die Weissagung des Propheten Jesaj a (S. 716/ 717) um 1610 Peter Candid, Die Tochter des Jiftach (S. 230) um 1610 Frans Francken d.J., Die Opferung Isaaks (S. 1156) 1612 Rubens, Die Kreuzabnahme (S. 1109) um 1612 Rubens, Jesus am Kreuz (S. 560) um 1613 Rubens, Die Beweinung Christi (S. 1212) 1614 Rubens, Jesus übergibt Petrus die Schlüssel des Himmelreichs (S. 990) 1616 Jacob Pynas, Nebukadnezzar erhält die Königswürde zurück (S. 884/885) 1616 Rubens, Das Große Jüngste Gericht (S. 1293) um 1616 Rubens, Die Niederlage des Sanherib (S. 354) um 1616/17 Anthonis van Dyck, Die Beweinung Christi (S. 1239) um 1618 Rubens, Jesus und die reuige Sünderin (S. 1047) um 1616/18 Gerard van Honthorst, Die Befreiung Petri (S. 1128) um 1618/20 Anthonis van Dyck, Die Ausgießung des Hei- ligen Geistes (S. 1117) um 1618/20 Rubens, König David, die Harfe spielend (S. 555) 1619-22 Rubens, Engelsturz (S. 1287) 1620 Rubens, Der Lanzenstich (S. 1107) um 1620 Hendrick ter Brugghen, Esau verkauft sein Erstgeburtsrecht (S. 39) um 1620 Frans Francken d. J., Der reiche Mann und der arme Lazarus (S. 1064/1065) um 1620 Frans Francken d. J., Die Begegnung von Ab- raham und Melchisedek (S. 26) um 1620 Gerard van Honthorst, Jesus vor dem Hohen- priester (S. 1105) um 1620 Jacob Jordaens, Der Sündenfall (S. 1190) um 1620 Rubens, Die Verstoßung Hagars aus dem Haus Abrahams (S. 33) um 1620 Rubens und Jan Brueghel d. Ä., Madonna im Blumenkranz (S. 657) 1620/21 Anthonis van Dyck, Die eherne Schlange (S. 147) 1624 Abraham Bloemaert, Das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen/Warnung vor Müßiggang (S. 984) 1624/25 Rubens, Das apokalyptische Weib (S. 1285) 1625 Rembrandt, Die Steinigung des Stephanus (S. 1122) 1625 (?) Rembrandt, David übergibt Goliats Haupt König Saul (S. 268) 1625 Rubens, Die Anbetung der Könige (S. 969) 1626 Rembrandt, Bileam und die Eselin (S. 151) 1626 Rembrandt, Tobit bittet um seinen Tod (S. 34) 1626 Rembrandt, Jesus treibt die Wechsler aus dem Tempel (S. 1082) 1626 Rembrandt, Die Taufe des Mohrenkämme-rers(S.1125) 1627 Rembrandt, Das Gleichnis vom Reichen/Der Geldwechsler (S. 1057) 1627 Rembrandt, Paulus im Gefängnis (S. 1145) 1626 Roelant Savery, Das Paradies (S. 12/13) um 1627 Hendrick ter Brugghen, Jakob und Laban (S. 45) um 1627 Rembrandt, Simeon und Hanna im Tempel (S. 1041) 1628 (?) Rembrandt, Simson und Delila (S. 239) 1629/30 Rubens, Krieg und Frieden (Friedensalle- gorie) (S. 502/503) 1630 Rembrandt, Der Prophet Jeremia (S. 821) 1630 Abraham Bloemaert, Landschaft mit Bau-erngehöft, Bauern und dem Auszug des Tobias mit dem Engel (S. 437) um 1630 Rembrandt, David vor Saul die Harfe spie- lend (S. 198) 1631 Willem Claesz. Heda, Ein Frühstückstisch mit einer Brombeerpastete (S. 1088/1089) 1631 Jacob Symonsz. Pynas, Josef wird von seinen Brüdern in den Brunnen geworfen (S. 53) um 1631 Matteus Stom, Jesus am Ölberg (S. 1030) 1632 Rembrandt, Studienkopf eines Alten (S. 611) 1633 Rembrandt, Die Kreuzabnahme (S. 1074) 1633 Rembrandt, Brustbild eines Mannes in orientalischem Kostüm (S. 423) um 1633 Rembrandt, Die Heilige Familie (S. 923) um 1633 Rembrandt, Die Kreuzaufrichtung (S. 1007) 1634 Nicolaes Maes, Die Verstoßung der Hagar (S. 1199) 1634 Rembrandt, Der Gelehrte (Alter Rabbiner) (S. 9) 1634 Rembrandt, Der ungläubige Thomas (S. 1111) um 1634 Rembrandt, Die Predigt Johannes' des Täu- fers (S. 1080) um 1635 Rubens, Batseba am Springbrunnen, Davids Brief erhaltend (S. 290) um 1635 Rembrandt, Das Gastmahl des Belschazzar (S. 888/889) um 1635 Rembrandt, Selbstbildnis mit Saskia/Der ver- lorene Sohn (S. 1061) um 1635/40 Rubens, Der betlehemitische Kindermord (S. 796/797) 1636 Rembrandt, Die Opferung Isaaks (S. 35) 1636 Rembrandt, Tobias heilt seinen Vater (S. 441) 1636 Rembrandt, Die Himmelfahrt Jesu (S. 1115) 1636-39 Rembrandt, Jesu Grablegung (S. 1033) nach 1636 Rubens, Landschaft mit Regenbogen (S. 20) 1637 Rembrandt, Der Erzengel Rafael verläßt die Familie des Tobias (S. 443) 1637 Rembrandt, Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (S. 995) um 1637-43 Rembrandt, Die Beweinung Christi (S. 1183) 1638 Rembrandt, Simson, an der Hochzeitstafel ein Rätsel aufgebend (S. 236/237) 1638 Rembrandt, Die Auferstehung Christi (S. 1008) um 1638 Jacob van Geel, Waldige Landschaft mit Elija und der Witwe von Sarepta (S. 328/329) 1639 Govaert Flinck, Isaak segnet Jakob (S. 1246) 1639 Rembrandt, Die Mutter des Künstlers als Pro- phetin Hanna (S. 712) um 1640 Leonard Bramer, Die Auferweckung des La- zarus (S. 1098) um 1640 Jan Davidsz. de Heem, Memento mori/Toten- kopf neben einem Blumenstrauß (S. 526) um 1640/45 Leonard Bramer, Allegorie der Eitelkeit (S. 642) 1641 Rembrandt, Das Opfer des Manoach (S. 232/233) 1642 Rembrandt, Davids Abschied von Jonatan (S. 272) 1644 Rembrandt, Jesus und die Ehebrecherin (S. 1093) 1645 Rembrandt, Josefs Traum im Stall vom Betle-hem(S.970) um 1645 Gerard Dou, Das Tischgebet der Spinnerin (S. 975) 1646 Rembrandt, Die Anbetung der Hirten (S. 1039) 1647 Rembrandt, Sara erwartet Tobias in der Hochzeitsnacht (S. 439) 1647 Rembrandt, Susanna und die beiden Ältesten (S. 897) 1648 Jan Davidsz. de Heem, Kelch und Hostie, umgeben von Fruchtgirlanden/Allegorie des Abendmahls (S. 1002) 1648 Rembrandt, Das Mahl in Emmaus (S. 1077) 1650 Rembrandt-Werkstatt, Hanna im Tempel, Samuels Gebet lauschend (S. 253) um 1650 Jan Brueghel d. J., Der Einzug der Tiere in die Arche Noach (S. 18) um 1650 Jacob Jordaens, Jesus und seine Jünger beim Sturm auf dem See (S. 1016/1017) um 1650 Rembrandt, Christus (S. 965) um 1650 Rembrandt-Werkstatt, Der Evangelist Johan- nes (S. 1277) um 1650 Adriaen van Stalbemt (Umkreis), Salomo und die Königin von Saba (S. 318/319) um 1650/60 Gerbrandt van den Eeckhout, Isaak und Re- bakka (S. 1161) 1651 Jan Davidsz. de Heem, Früchte- und Blumenkartusche mit Weinglas (S. 2) um 1653-55 Jacob Isaacksz. van Ruisdael, Der Judenfried- hof von Ouderkerk (S. 698/699) 1654 Rembrandt, Bildnis einer alten Frau/Die Mutter des Künstlers (?) (S. 639) 1654 Rembrandt, Batseba mit der Botschaft König Davids (S. 573) 1655 Rembrandt, Josefund die Frau des Potiphar/ Die Verleumdung (S. 56) um 1655 Jan Vermeer van Delft, Jesus im Haus von Maria und Marta (S. 1053) 1656 Jan Vermeer van Delft, Bei der Kupplerin (S. 621) 1656 Rembrandt, Jakob segnet Josefs Söhne (S. 64) 1658/59 Rembrandt, David spielt vor Saul (S. 265) 1659 Rembrandt, Mose zerschmettert die Geset- zestafeln (S. 93) 1659 Rembrandt, Jesus und die Samariterin am Brunnen (S. 1085) um 1659/60 Rembrandt, Jakob ringt mit dem Engel (S-49) 1660 Rembrandt, Die Verleugnung durch Petrus (S. 1004) 1661 Rembrandt, Der Evangelist Matthäus wird vom Engel inspiriert (S. 966) 1661 Rembrandt, Der auferstandene Christus (S. 1178) um 1662 Rembrandt, Die Heimkehr des verlorenen Sohnes (S. 1062) 1663 Karel Dujardin, Paulus heilt den Lahmen in Lystra (S. 1132) 1664 Jacob Jordaens, Wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen (S. 660) vor 1665 Gerrit Dou, Stillleben mit Leuchter und Ta- schenuhr (S. 644) um 1665 Jan Davidsz. de Heem, Stilleben mit Blumen- strauß und Kruzifix (S. 1155) um 1668-70 Jan Steen, Amnon und Tamar (S. 294/295) 1669 Gerbrand van den Eeckhout, Jakobs Traum von der Himmelsleiter (S. 43) 1670 Jan de Bray, David mit der Harfe/Überfüh- rung der Bundeslade (S. 374) 1671/74 Jan Vermeer van Delft, Allegorie des Glau- bens (S. 1197) 1684 Aert de Gelder, Ester vor ihrem Gang zu Ahasver (S. 469) vor 1685 Aert de Gelder, Ester und Mordechai (S. 465) um 1685 Aert de Gelder, Artaxerxes mit Mordechai und Ester (S. 472) |
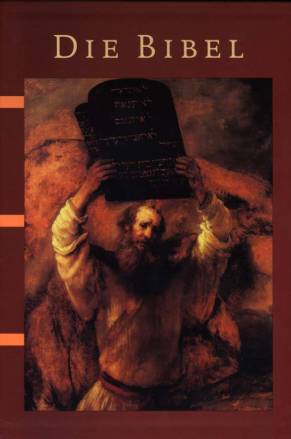
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen