|
|
|
Umschlagtext
Hans-Ulrich Wehlers Deutsche Gesellschaftsgeschichte gehört zu den herausragenden historischen Werken unserer Zeit. Vor rund zwanzig Jahren erschien der erste Band über Deutschland von 1700 bis 1815 und wurde sofort ein großer Erfolg. Mit diesem eindrucksvollen fünften Band gelangt ein epochales Werk zum Abschluß, das mehr als dreihundert Jahre deutscher Geschichte umspannt und eine ganze Generation von Historikern geprägt hat. Es wird auf lange Sicht kaum ein anderes Werk geben, das in vergleichbarem Umfang die deutsche Geschichte zur Darstellung bringt.
„Eine Meisterleistung deutscher Geschichtsschreibung.“ Richard J. Evans, Frankfurter Rundschau „Ein gigantisches Projekt, das die Arbeitskraft eines einzelnen Forschers zu überfordern schien.“ Volker Ullrich, Die Zeit „Ein beeindruckendes Zeugnis des Anspruchs und der Produktivität, die Wehler zu einer herausragenden Figur des intellektuellen Deutschlands gemacht haben.“ Hermann Rudolph, Der Tagesspiegel Rezension
Im Jahre 2008 legte der international anerkannte Historiker Hans-Ulrich Wehler (*1931) den letzten Band seiner „Deutschen Gesellschaftsgeschichte“ vor, ein Ereignis, das die Frankfurter Allgemeine Zeitung zum Anlass nahm, Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen zu einer Rezension des Buches aufzufordern. Der Bielefelder Wissenschaftler bleibt in seinem fünften Werk zur deutschen Gesellschaftsgeschichte, die den Zeitraum von der doppelten Staatsgründung 1949 bis zum wiedervereinigten Deutschland 1990 behandelt, seinem strukturtheoretischen Ansatz treu. In Anlehnung an Max Weber untersucht der Sozialhistoriker in dem Zeitraum die Triade Wirtschaft, (politische) Herrschaft, Kultur, ergänzt um die Kategorie soziale Ungleichheit. Mit diesem Konzept grenzt sich Wehler sich von einer narrativen und politisch dominierten Geschichtschreibung ab. Selbstkritisch bemerkt der Historiker, dass bei der neu gestalteten Gesellschaftsgeschichte auch die Sphäre des Rechts einer besonderen Berücksichtigung bedarf.
In dem „Epilog“ seines neuen Buches gibt der Wissenschaftler einen Überblick über Kontinuitäten und Diskontinuitäten der deutschen Geschichte von 1700 bis 1990. So konnte Wehler in seinen fünf Bänden „eine verblüffende Diskontinuität im Bereich der politischen Herrschaft und der politischen Ideenwelt“(S. 424) nachweisen. Demgegenüber offenbart die deutsche Geschichte seit dem 18. Jahrhundert eine „bestehende Kontinuität im Bereich der Stratifikationsordnung der großen Sozialformationen und des wirtschaftlichen Systems“(S. 424). Auch der gegenwärtigen Gesellschaft attestiert Wehler noch ein hohes Maß an sozialer Ungleichheit. Deshalb tritt er für eine weitere Modernisierung der bundesrepublikanischen Gesellschaft ein. Zu seinen Forderungen gehört eine Überprüfung und Korrektur der „sozialökonomischen Disparitäten im Licht der Chancengerechtigkeit“, eine „gezielte Integrationspolitik“ und eine Einhegung des „internationale[n] Turbokapitalismus der Globalisierung“(S. 438f.) Wehlers neuester Band zur Gesellschaftsgeschichte zeugt von der fundierten Auswertung einer geradezu unermesslichen Fülle von Quellen- und Forschungsliteratur, was der 60 Seiten umfassende, Anmerkungsteil belegt. Allein dieser in seiner Verdichtung einmalige Überblick über einzelne Segmente der deutschen Gesellschaft von 1949-1990 ist als ein Meisterwerk zu würdigen, auch wenn der Leser nicht jedes von Wehler gefällte historische Urteil teilen mag. Beispielsweise kommen die Erfahrungen der DDR-Bürger in seiner Darstellung eindeutig zu kurz. Für den Historiker war die DDR nicht mehr als eine „sowjetische Satrapie“, außerdem habe die „kurzlebige Existenz der DDR […] in jeder Hinsicht in eine Sackgasse geführt“(S. XV). Damit rechtfertigt der Wissenschaftler, dass in seiner Darstellung der deutschen Geschichte nach 1945 der Fokus auf der historischen Analyse der Bundesrepublik Deutschland liegt. Außerdem vermisst der Leser in Wehlers Buch, worauf der Literaturwissenschaftler Hans Ulrich Gumbrecht in einer Rezension (vgl. FAZ vom 30.9.2008, Nr. 229, S. 39) aufmerksam macht, die Berücksichtigung von langfristig bedeutsamen Stimmungen wie des „Wir sind wieder wer“-Gefühls infolge des Gewinns der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 oder der Zuversicht der DDR-Bürger Ende der 1980er Jahre. Diese kritischen Einwände können aber über Wehlers historische Leistung nicht hinwegtäuschen. Fazit: Wehlers fünfter Band seiner „Deutsche Gesellschaftsgeschichte“ mit dem Titel „Bundesrepublik und DDR 1949-1990“, erschienen im Verlag C.H. Beck, ist schon jetzt ein Standardwerk der Geschichtswissenschaft, das Bestand jeder guten Lehrerbibliothek sein sollte. Dr. Marcel Remme, für lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Wehlers tragendes Konzept ist gleich geblieben – und es trägt auch für die Zeit nach 1945: Politische Herrschaft und Kultur, Wirtschaft, soziale Ungleichheit stehen im Zentrum der Darstellung, die immer wieder die Frage umkreist, wie Herrschaft organisiert wird und welche soziale Realität sie hervorbringt. Daß dabei das Urteil über die DDR höchst kritisch ausfällt, mag nicht weiter überraschen. Doch auch die Bundesrepublik, so zeigt sich, weist bei aller demokratischen Verfasstheit überraschende Kontinuitäten sozialer Schichtung und Ungleichheit auf. Das gern gepflegte Bild von der offenen Gesellschaft mit Aufstiegsmöglichkeiten für jedermann erweist sich bei genauerer Betrachtung als empirisch wenig stichhaltig – vor allem die Kontinuität der Eliten und der Besitzverhältnisse ist, wie Wehler herausarbeitet, ein Kennzeichen auch der westlichen Demokratie der Nachkriegszeit. [Prof. Dr.] Hans-Ulrich Wehler war bis zu seiner Emeritierung Professor für Allgemeine Geschichte an der Universität Bielefeld. Inhaltsverzeichnis
Hans-Ulrich Wehlers Deutsche Gesellschaftsgeschichte gehört zu den herausragenden historischen Werken unserer Zeit. Vor rund zwanzig Jahren erschien der erste Band über Deutschland von 1700 bis 1815 und wurde sofort ein großer Erfolg. Mit diesem eindrucksvollen fünften Band gelangt ein epochales Werk zum Abschluß, das mehr als dreihundert Jahre deutscher Geschichte umspannt und eine ganze Generation von Historikern geprägt hat. Es wird auf lange Sicht kaum ein anderes Werk geben, das in vergleichbarem Umfang die deutsche Geschichte zur Darstellung bringt.
„Eine Meisterleistung deutscher Geschichtsschreibung.“ Richard J. Evans, Frankfurter Rundschau „Ein gigantisches Projekt, das die Arbeitskraft eines einzelnen Forschers zu überfordern schien.“ Volker Ullrich, Die Zeit „Ein beeindruckendes Zeugnis des Anspruchs und der Produktivität, die Wehler zu einer herausragenden Figur des intellektuellen Deutschlands gemacht haben.“ Hermann Rudolph, Der TagesspiegelInhaltsverzeichnis Vorwort Elfter Teil Bundesrepublik und DDR 1949–1990 I. Politische Rahmenbedingungen in den beiden Neustaaten A. Die Bundesrepublik 1. Die Verfassungsordnung 2. Die Parteien und Verbände 3. Die Bürokratie 4. Die Radikalisierung blieb aus 5. Das neue Militär 6. Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus – Die neue Politische Kultur B. Die DDR 1. Der kurze Weg in die SED-Diktatur 2. Der politische Umbau der ostdeutschen Gesellschaft 3. Der Arbeiteraufstand von 1953 4. Der «Aufbau des Sozialismus» 5. Die Mauer: Die DDR igelt sich ein II. Turbulenzen der Bevölkerungsgeschichte A. Die Bundesrepublik Wanderungsströme – Fertilitäts- und Mortalitätsrückgang – Arbeitsmigration 1. Bevölkerungswachstum durch deutsche Zuwanderung 2. Der Fertilitätsrückgang 3. Der Mortalitätsrückgang 4. Die Zuwanderung von Arbeitsmigranten, Spätaussiedlern und Asylbewerbern B. Die DDR Bevölkerungsgeschichte eines Abwanderungslandes III. Strukturbedingungen und Entwicklungsprozesse der Wirtschaft A. Die Bundesrepublik 1. Die Ursachen des «Wirtschaftswunders» 2. Das deutsche «Wirtschaftswunder» im «Goldenen Zeitalter« des westlichen Kapitalismus von 1950 bis 1973 3. Vom Ölpreisschock zur Wiedervereinigung: Die Ursachen des verlangsamten Wachstums 4. Die gemischte Bilanz des Handwerks 5. Gab es eine Amerikanisierung der westdeutschen Wirtschaft nach 1945? 6. Europäisierung und Globalisierung 7. Der Ausbau der Sozialen Marktwirtschaft 8. Die Konsumgesellschaft im Aufwind 9. Die Landwirtschaft im säkularen Strukturwandel: Der kostspielige Weg in eine lukrative Nische B. Die DDR 1. Belastungen: Demontage, Reparationen, Teilungsfolgen, Massenflucht 2. Der Fetisch der kommunistischen Planwirtschaft 3. Die «Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik» 4. Der Niedergang 5. Das Debakel der «sozialistischen Landwirtschaft» 6. Die Ursachen des Scheiterns IV. Strukturbedingungen und Entwicklungsprozesse der Sozialen Ungleichheit A. Die Bundesrepublik 1. Vermögens- und Einkommensverteilung 2. Die Eliten 3. Renaissance des Bürgertums oder amorphe «Mittelschichten»? a) Die bürgerlichen Mittelklassen b) Dienstklassen oder «neuer Mittelstand»? Die Angestellten c) Der «alte Mittelstand»: Handwerk und Einzelhandel 4. Der Aufstieg der Arbeiterschaft aus dem Proletariat 5. Die Randschicht der Armen 6. Der Adel: Politisches Ende und Überleben als «Prestige-Oberschicht» . 7. Auf dem Weg in die Versorgungsklasse: Die Bauern 8. Die Ungleichheit der Geschlechter: Die Verringerung der Frauendiskriminierung 9. Die klassenspezifi schen Heiratsmärkte: Soziale Schließung durch Homogamie 10. Stabilitätsanker oder Auslaufmodell? Die Familie 11. Weichenstellung zur Ungleichheit: Jugend-Generationen 12. Ungleichheit im Alter 13. Die klassenspezifi sche Wahrnehmung der Bildungschancen 14. Elemente klassenspezifi scher Ungleichheit: Gesundheit, Kriminalität, Politische Teilhabe und Sozialräume 15. Die Ungleichheit der Wohnbedingungen und die städtische Segregation 16. Der verschwundene Gegensatz: Die Ungleichheit der Konfessionen 17. Die deutsche Sozialhierarchie: Klassendisparitäten in der Marktgesellschaft B. Die DDR 1. Die Klassenstruktur der DDR 2. Die herrschende Klasse: die SED-Monopolelite 3. Die administrative Dienstklasse 4. Die operative Dienstklasse 5. Die industrielle Arbeiterklasse 6. Die ländliche Arbeiterklasse der «Genossenschaftsbauern» 7. Die Reste des Bürgertums 8. Die Ungleichheit der Geschlechter 9. Einkommensunterschiede V. Strukturbedingungen und Entwicklungsprozesse Politischer Herrschaft A. Die Bundesrepublik 1. Grundlinien des politischen Systems 2. Die Westintegration 3. Die Europapolitik 4. Die Deutschlandpolitik 5. Die Politik der Wiedergutmachung 6. Der Ausbau des Sozialstaats 7. Die Entstehung einer kritischen Öffentlichkeit als Vierte Gewalt 267 8. Die neue Politische Kultur 9. Die Folgen des Antisemitismus 10. Der Niedergang des deutschen Nationalismus nach 1945 11. Die Bundeswehr im Dauerkonflikt zwischen Reformern und Traditionalisten 12. Die 68er-Bewegung: Triumph oder Debakel? 13. 1989/90: Die Fusion der beiden deutschen Neustaaten B. Die DDR 1. Innen- und außenpolitische Konsolidierung 2. Die Ära Honecker 3. Sozialpolitik als scheiternder Legitimationsspender 4. Pathologisches Lernen im linkstotalitären System a) Faschismustheorie, Antifa und Externalisierung der Mitschuld b) Antisemitismus, Antizionismus und verweigerte Wiedergutmachung c) Militarisierung der Gesellschaft und Friedensrhetorik d) Resistenzmilieu ohne Dissidentenbewegung 5. Die Herrschaftsprinzipien und Machtgrenzen des DDR-Sultanismus 6. Der Absturz in den Niedergang VI. Strukturbedingungen und Entwicklungsprozesse der Kultur A. Die Bundesrepublik 1. Die Christlichen Kirchen a) Der westdeutsche Protestantismus b) Der westdeutsche Katholizismus 2. Das Schulsystem: Grundschule – Hauptschule – Gesamtschule – Realschule und Gymnasium 3. Die Universitäten 4. Der literarisch-publizistische Markt a) Die Bücherproduktion b) Zeitungen und Zeitschriften 5. Vom Rundfunk und Film zur massenmedialen Revolution des Fernsehens 6. Der neu gewonnene und verteidigte Pluralismus der Öffentlichkeit B. Die DDR 1. Der Kulturkampf gegen die Kirchen 2. Schulen und Universitäten unter der SED-Diktatur 3. Die doppelte Diktaturerfahrung Epilog: Rückblick und Ausblick Anhang Anmerkungen Abkürzungsverzeichnis Personenregister Sachregister |
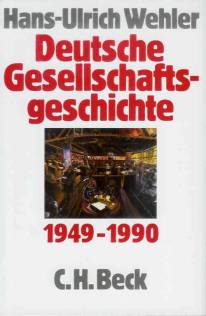
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen