|
|
|
Umschlagtext
Der Klassiker der Namenstage!
„Der Torsy" ist seit vielen Jahren zu einem Begriff geworden: Ausführlichkeit, Sachkenntnis, Übersichtlichkeit und aktuellster Stand mit fast 4.000 Namen und 1.680 Lebensbeschreibungen haben dieses Buch zu einem Standardwerk gemacht. Darüber hinaus gibt es Hinweise zu den Patronaten der Heiligen und Seligen sowie darauf, wie sie in Kunst und Volksfrömmigkeit dargestellt werden, und erklärt die Bedeutung der Namen. JAKOB TORSY, 1908-1990, Dr. theol., war 1952-1986 im historischen Archiv des Erzbistums Köln tätig und maßgeblich am Aufbau und der Verbesserung des Archivwesens in Deutschland beteiligt. HANS-JOACHIM KRACHT, geb. 1940, Dr. theol., seit 1993 Chefredakteur der deutschsprachigen Ausgabe des „Osservatore Romano" im Vatikan. Verlagsinfo
Der Klassiker der Namenstage - jetzt völlig überarbeitet und aktualisiert. »Der Torsy« ist seit vielen Jahren zu einem Begriff geworden: Ausführlichkeit, Sachkenntnis, Übersichtlichkeit und aktueller Stand mit jetzt 3.850 Namen und 1.680 Lebensbeschreibungen haben dieses Buch zu einem Standardwerk gemacht. Es vermittelt in seinen Lebensbeschreibungen einen plastischen Eindruck der Heiligen und Seligen und ihrer Zeit. Darüber hinaus gibt es Hinweise zu ihren Patronaten und darauf, wie sie in Kunst und Volksfrömmigkeit dargestellt werden. Inhaltsverzeichnis
ZUM GELEIT
Im Jahr 1969 wurde der alte römische Kalender durch das neue »Calendarium Romanum Generale« ersetzt, das einerseits um etwa ein Drittel weniger Feiern enthielt, andererseits für nicht wenige Heilige neue Daten angab. Die Veröffentlichung des neuen Kalenders löste eine unerwartet starke Welle von Protest und Kritik aus. Es schien so, als hätte die nachkonziliare Kirche viele Heilige, darunter sehr populäre und traditionsverwurzelte Namenspatrone wie Barbara, Christoph, Katharina, Margareta aus dem Himmel gejagt. Was war geschehen? Die Konzilsväter des II. Vatikanums hatten beschlossen, die längst notwendige Reform des liturgischen Kalenders auf ein wichtiges Ziel hinzuordnen: Die Feier der Erlösungsgeheimnisse im Kirchenjahr sollte kräftig unterstrichen und ihr gegenüber der Feier der Heiligen der gebührende Vorrang eingeräumt werden. Die fast tägliche Feier von Heiligenfesten, darunter viele von nahezu unbekannten Heiligen, deren Verehrung im Volk kaum verbreitet war, hatte in der Liturgie von Messe und Stundengebet tatsächlich die Feier der Erlösung durch Christus stark beeinträchtigt. Dieser Missstand sollte dadurch beseitigt werden, dass künftig nur die Feier jener Heiligen, die von unbestreitbar gesamtkirchlicher Bedeutung sind, in der ganzen römischen Kirche vorzusehen war; die Mehrzahl der Heiligen aber sollte den teilkirchlichen Kalendern überlassen bleiben. Diese Grundregel entsprach durchaus dem Sinn und der Geschichte der liturgischen Heiligenverehrung: Heilige gehören auf Grund ihres Lebens und ihrer Wirksamkeit zu einer bestimmten Ortskirche. Dort haben ihre Verehrung und ihre liturgische Feier ihren Ursprung, und von hier aus finden beide auch mehr oder weniger weite Verbreitung. Die Verantwortlichen für die Durchführung der Kalenderreform hatten aber eine Tatsache übersehen, die unbedingt zu berücksichtigen gewesen wäre. Das Wort »Kalender« hat beim christlichen Volk eine andere Bedeutung als in der Fachsprache der Liturgiker. Diese unterscheidet nämlich zwischen Kalender und Martyrologium: Der Kalender enthält die kirchenamtliche Regelung für die tägliche Gottesdienstfeier, das Martyrologium enthält umfassende Listen von Heiligen und Seligen in kalendarischer Ordnung. Das Volk aber, das diese Unterscheidung nicht kennt, will im Kaien- der möglichst alle Namenstage angemerkt finden, es erwartet gewissermaßen eine vollständige Heiligenliste. Ob diese vielen Heiligen im Gottesdienst der Kirche berücksichtigt werden oder nicht, ist für die meisten Menschen kaum von Interesse. Die heftige Kritik an der römischen Kalenderreform war also in erster Linie einem Missverständnis zuzuschreiben. Die Weiterfuhrung der Kalenderreform auf der Ebene des deutschen Sprachgebietes sollte darum nicht nur den richtigen Grundsätzen der nachkonziliaren Liturgiereform, sondern auch den berechtigten Erwartungen des Volkes Rechnung tragen und Missverständnisse vermeiden. Von Anfang an wurden daher zwei Ziele ins Auge gefasst: Ein »Regionalkalender« für die Liturgiefeier und ein »Namenstagskalender« für den Volksgebrauch sollten ausgearbeitet und veröffentlicht werden. Der liturgische Kalender - also die Regelung der Gottesdienstfeier im Lauf des Jahres - sollte jene Heiligen besonders hervorheben, die für die Kirche in unserer Heimat von hervorragender Bedeutung sind: - die wichtigsten Märtyrer des Sprachgebietes, - die wichtigsten Glaubensboten, die in unser Sprachgebiet gekommen oder von hier in die Mission gegangen sind, - bedeutende Heiligengestalten verschiedener Epochen und verschiedener Standeszugehörigkeit, - Erneuerer der Kirche, des Glaubenslebens, der Caritas, der Wissenschaft, - Heilige, die im ganzen Sprachgebiet oder großen Teilen desselben verehrt sind. Diese Heiligen sollten uns durch ihre regelmäßige Feier bekannt und vertraut bleiben, denn sie bilden für die meisten Christen den einzigen und wirksamsten Zugang zu einem lebendigen Verständnis unserer Kirchengeschichte. Der Regionalkalender warde 1971 von den Bischofskonferenzen des deutschen Sprachgebietes beschlossen, 1972 in Rom bestätigt, 1973 in Gebrauch genommen und ist Grundlage für das neue deutsche Messbuch und Stundengebet. Der zweite Kalender, der so genannte Namenstagskalender, sollte den Wünschen vieler Christen entgegenkommen, ihre Namenstage zu finden, aber darüber hinaus auch ihre Namenspatrone kennen zu lernen und einen Einblick in die unermesslich große Zahl von Heiligengestalten zu gewin- nen, die - jeder in seiner besonderen Weise - ein beispielhaftes christliches Leben geführt haben und uns heute Leitbild und Fürsprecher sind. Er stellt einen Auszug aus dem Martyrologium dar, bereichert durch einige Hin-zufügungen. Bei der Auswahl der Heiligen für diesen Kalender waren verschiedene Gesichtspunkte maßgebend: Einerseits sollte die Praxis der heutigen Namensgebung berücksichtigt werden, andererseits die überaus reiche Tradition der Heiligenverehrung unseres Gebietes hervorgehoben und die Aufmerksamkeit auf vorbildliche Christen aus Vergangenheit und Gegenwart gelenkt werden. Aus unserem Jahrhundert sind auch einzelne hervorragende Personen angeführt, die durchaus verehrungs- und nachahmungswürdig gelebt haben, aber nicht heilig oder selig gesprochen sind. Es steht nichts im Weg, auch solche Personen als Namenspatrone zu wählen. Der Gedenktag eines Heiligen und somit der »Namenstag« für den Träger seines Namens ist in der Regel der Todestag. Wenn der liturgische Gedenktag davon abweicht (etwa ein Kirchweihtermin, Übertragung von Reliquien, ein wichtiges Ereignis aus dem Leben usw.), sind beide Daten angeführt und als Namenstag wählbar. Bei vielen Heiligen gibt es verschiedene Formen, Übersetzungen oder Schreibweisen ihres Namen. Alle diese Formen sind im alphabetischen Register am Ende des Buches angeführt, damit die richtigen Heiligen leicht gefunden werden können. Wenn für bestimmte Namen mehrere Heilige genannt sind (so etwa Petrus, Johannes, Jakob ...), so steht es natürlich den Eltern bzw. dem Träger des Namens frei, sich für einen Namenspatron und damit auch für einen Namenstag zu entscheiden. Der mit großer Sorgfalt und Sachkenntnis erarbeitete »Namenstagskalender« wird nun der Öffentlichkeit übergeben. Er sollte dazu beitragen, dass Paten oder Eltern auf der Suche nach Namen für ihre Kinder nicht nur nach gerade gängiger Mode oder wegen des Wohlklangs eines Namens entscheiden, sondern dass sie nach bewährter Tradition einen ganz bestimmten Patron als Vorbild und Fürsprecher für ihr Kind auswählen. PHILIPP HARNONCOURT |
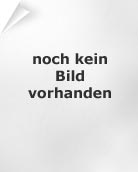
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen