|
|
|
Umschlagtext
Die Verbindung von ironistischer Beliebigkeit und Digitalisierung zu einem Lebenkönnen in grenzenloser Kombinierbarkeit wird getragen von den gleichsam selbstläufigen, unabsehbaren Fortschritten der Maschinentechnik, denen die Naturwissenschaft mit glänzenden Prognosen der Erfolge selektiver Eingriffe in die empirische Außenwelt den Weg weist. An diesen Früchten einer jahrtausendelangen Entwicklung des abendländischen Geistes ist die Philosophie als maßgebend treibende und Motive gebende Kraft beteiligt; ihre Anregungen kamen aber nur deshalb zu so breiter Geltung, weil sie zweimal aus anderer Quelle mit unvorhersehbar gewaltiger Dynamik aufgeladen wurden: zuerst durch das Christentum und dann durch die Naturwissenschaft unter Führung der Physik und die von ihr ermöglichte und angebahnte moderne Maschinentechnik.
Rezension
Lehrer/innen kommen ohne philosophiegeschichtliche Grundkenntnisse kaum aus; viel zu sehr haben die jeweiligen geistesgeschichtlichen Strömungen auch die jeweilige Pädagogik beeinflußt. Philosophie-, Gesellschaftskunde- und Religionslehrkräfte benötigen darüber hinaus spezifisches Fachwissen zur Philosophiegeschichte. Das bietet diese 2-bändige Ausgabe. - Die Darstellung aber ist durchaus eigenständig und eigenwillig: so beginnt die Nachantike in den Augen des Verfassers mit dem Urchristentum (vgl. Kap. 19) und die Existenzphilosophie wird unter der Phänomenologie subsumiert (Kap. 45) und die Lektüre erweist sich auch sprachlich als nicht ganz einfach.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Es ist an der Zeit, Geschichte der Philosophie nicht mehr nur als geschätztes, aber unverbindliches Bildungsgut zu erzählen, sondern zu prüfen, was die Philosophie auf ihrem Weg durch die Geschichte Europas den Menschen „angetan" hat, im Guten wie im Bösen. Dieses Ziel setzt sich Hermann Schmitz in einem zweibändigen Werk, indem er diesen Weg analytisch und kritisch von Homer bis Merleau-Ponty nachzeichnet. Der zweite Band setzt beim Urchristentum ein, das zum archaischen Denken hinter die demokritisch-platonische (psychologistisch-reduktionistisch-introjektionistische) Vergegenständlichung zurückspringt, damit aber schon bei Augustinus, der durch ein im Dienst eigenen Glücks bloß utilitaristisches Verhältnis zur Welt neuzeitliches Denken tendenziell vorwegnimmt, keine Rolle mehr spielt. Dieser Vergegenständlichung kommt in der Scholastik, im Zuge des Universalienproblems und des Verständnisses von Einheit, der Singularismus zu Hilfe, der sich bei Wilhelm von Ockham radikal durchsetzt. Singularismus ist die Überzeugung, dass alles ohne Weiteres einzeln ist. Er ebnet den Weg zum Konstellationismus, der die Welt als Netzwerk einzelner Faktoren deutet. Singularismus als Konstellationismus ist zusammen mit dem demokritisch-platonischen Paradigma der Schlüssel theoretischer und technischer Weltbemächtigung, seit die Menschen diese von Bacon an in die eigenen Hände genommen haben. Kant ist der erste, dem der Singularismus so selbstverständlich ist, dass er ihn nicht mehr zu verständigen und zu rechtfertigen braucht. Erst nach Kant bemerkt ein Philosoph (Fichte), dass jeder, der „Wer bin ich?" fragt, mit dem Erfragten nicht bei den objektiven oder neutralen Tatsachen unterkommt. Da aber alle Tatsachen für objektiv gehalten werden, scheint dieses Erfragte in eine rätselhafte Schwebelage über oder zwischen allen Tatsachen zu geraten. Damit beginnt das (noch nicht abgeschlossene) ironistische Zeitalter im Zeichen der (romantischen) Ironie und Ichangst; zum heimlichen Leitmotiv der Philosophie wird die Alternative von Aushalten (Existenzphilosophie) und Abweisen der Paradoxie, begleitet von Wiederbelebung der neuplatonischen Vieleinigkeit im Deutschen Idealismus (besonders bei Hegel), in der Lebensphilosophie und beim späten Heidegger. Autoreninfo: Hermann Schmitz, geb. 1928 in Leipzig, 1971-1993 ordentlicher Professor für Philosophie an der Universität Kiel. Begründer der Neuen Phänomenologie, die bestrebt ist, die Abstraktionsbasis der Begriffsbildung tiefer in der unwillkürlichen Lebenserfahrung zu verankern. Seine systematischen und historischen Publikationen (40 Bücher, gegen 120 Aufsätze) sollen dazu dienen, den Menschen ihr wirkliches Leben begreiflich zu machen, indem nach Abräumung geschichtlich geprägter Verkünstelungen der Besinnung ein begrifflich gestützter Zugang zur unwillkürlichen Lebenserfahrung geöffnet wird. Inhaltsverzeichnis
Band II: Nachantike Philosophie
Überleitung 15 19. Das Urchristentum 23 19.1 Der Leib im Bann der Mächte 23 19.2 Der christliche Wartestand 28 19.3 Nuancen 32 20. Augustinus 36 20.1 Beherrschen, Benützen und Genießen 36 20.2 Isolierung und Uniformierung 41 20.3 Rette sich, wer kann! 49 21. Das Universalienproblem 53 21.1 Systematische Vorbereitung 53 21.2 Die Frühzeit 59 21.3 Die Hochscholastik 68 21.4 Die Spätscholastik 78 22. Thomas von Aquino 87 22.1 Die Quantifizierung der Bestimmtheit 87 22.2 Das Sein und das Nichts 94 22.3 Die Skalierung der Bestimmtheit 98 22.4 Die Materie 103 22.5 Thomas und Aristoteles 106 23. Johannes Duns Scotus 110 23.1 Die distinctio formalis 110 23.2 Die Mannigfaltigkeitslehre 113 23.3 Die Qualifizierung der Bestimmtheit 118 23.4 Die letzten Differenzen 126 24. Wilhelm von Ockham 133 24.1 Der Singularismus 133 24.2 Die Kappung der Zusammenhänge 137 24.3 Die Universalien 147 24.4 Das Subjekt 150 25. Meister Eckhart und die Folgen 155 25.1 Das Sein 155 25.2 Der Mensch 162 25.2 Meister Eckhart und Wilhelm von Ockham 168 25.4 Die Folgen 171 26. Nikolaus von Kues 180 26.1 Gott: das Nicht-andere (non aliud) 180 26.2 Gott: das Könnist (possest) 184 27. Paracelsus 190 27.1 Die geschichtliche Stellung der Philosophie des Paracelsus 190 27.2 Die Konkordanz 196 27.3 Begriffe aus vielsagenden Eindrücken 201 27.4 Salz, Schwefel und Quecksilber 205 28. Bacon 211 29. Hobbes 218 29.1 Der Körper 218 29.2 Der Staat 224 30. Descartes 228 30.1 Der Dualismus 228 30.2 Die Subjektivität 236 30.3 Gott 242 30.4 Der Elementarismus 245 31. Spinoza 249 31.1 Gott 249 31.2 Einheit und Vielheit 254 32. Leibniz 258 32.1 Was wollte Leibniz? 258 32.2 Der Darwinismus der Möglichkeiten 265 32.3 Gott 269 32.3.1 Das vollkommene Wesen 269 32.3.2 Das notwendige Wesen 276 32.3.3 Das zwiespältige Wesen 278 32.4 Die Monaden 284 32.5 Das Kontinuum 289 33. Locke 297 33.1 Die Wende 297 33.2 Locke und Descartes 299 33.3 Locke und Platon 301 34. Hume 308 34.1 Humes Rache an Locke 308 34.2 Humes Methode 312 35. Kant 316 35.1 Die geschichtliche Stellung der Philosophie Kants 316 35.2 Die Motivation der Philosophie Kants 328 35.2.1 Der transzendentale Idealismus 328 35.2.2 Die kopernikanische Wende und der kritizistische Immanentismus 336 35.3 Die Kritik der reinen Vernunft 347 35.3.1 Die Entstehung der Kritik der reinen Vernunft 347 35.3.2 Die transzendentale Ästhetik 358 35.3.3 Die transzendentale Analytik 369 35.3.4 Die transzendentale Dialektik 384 35.4 Praktische Philosophie 396 35.4.1 Das Sittengesetz 396 35.4.2 Die Triebfeder der Sittlichkeit 403 35.4.3 Das Verhältnis der praktischen zur Transzendentalphilosophie 409 35.5 Ästhetik 415 36. Fichte 422 36.1 Ich 422 36.2 Die rezessive Entfremdung der Subjektivität 428 36.3 Die Wissenschaftslehre 437 37. Schelling 450 38. Die Frühromantiker und Stirner 460 39. Hegel 471 39.1 Die Denkform der Philosophie Hegels 471 39.2 Die Motivation der Philosophie Hegels 483 39.3 Die Logik 488 39.3.1 Wissenschaft der Logik 488 39.3.2 Die Entwicklung der Logik Hegels 498 39.4 Das System 504 39.5 Die Dialektik der Standpunkte 508 40. Kierkegaard 520 41. Schopenhauer 531 42. Nietzsche 541 42.1 Nietzsche im Gefolge des Christentums 541 42.2 Nietzsche im Gefolge der Frühromantik 547 42.3 Die vornehme Moral 556 42.4 Die Erkenntnistheorie 559 42.5 Die ewige Wiederkehr 562 43. Positivismus 567 43.1 Empiriokritizismus 567 43.2 Wittgenstein 575 43.2.1 Die rezessive Entfremdung der Subjektivität 575 43.2.2 Der Singularismus 580 43.2.3 Gegen die Introjektion 586 43.3 Logischer Positivismus 588 43.3.1 Frege 588 43.3.2 Russell 595 43.3.3 Carnap 600 43.4 Analytische Philosophie 604 43.4.1 Charakteristik 604 43.4.2 Quine 609 43.4.3 Strawson 617 43.4.4 Philosophie des Geistes 620 44. Lebensphilosophie 628 44.1 Bergson 628 44.2 Dilthey 635 44.3 Klages 643 44.3.1 Die Grundzüge des Systems 643 44.3.2 Kritik 647 44.3.3 Die Errungenschaften 653 45. Phänomenologie 662 45.1 Husserl 662 45.1.1 Intentionalität 662 45.1.2 Singularismus 667 45.1.3 Subjektivität 673 45.1.3.1 Bewusstsein 673 45.1.3.2 Transzendentale Subjektivität 678 45.1.3.3 Intersubjektivität 686 45.1.4 Evidenz und Wahrheit 691 45.1.5 Sinnlichkeit und Verstand 694 45.1.6 Die Wesensschau 698 45.2 Materiale Wertethik 703 45.2.1 Max Scheler 703 45.2.2 Nicolai Hartmann 714 45.3 Heidegger 721 45.3.1 Die rezessive Entfremdung der Subjektivität 721 45.3.2 Die existenziale Analytik 727 45.3.3 Die Preisgabe der existenzialen Analytik 738 45.3.4 Langeweile und Zuspitzung 745 45.3.5 Das Geschehen der Wahrheit 748 45.3.6 Das Sein 754 45.3.6.1 Heideggers Seinsverständnis 754 45.3.6.2 Die Entkräftung des Seins 758 45.3.6.3 Die Seinsgeschichte 767 45.3.7 Der eschatologische Neuplatonismus 773 45.4 Sartre 778 45.4.1 Subjektivität 778 45.4.2 Ansichsein 786 45.4.3 Der Andere 789 45.4.4 Existenzialismus 796 45.4.5 Hermeneutik synästhetischer Charaktere 798 45.4 Merleau-Ponty 800 45.5.1 Phenomenologie de la Perception 800 45.5.2 Le Visible et Hnvisible 806 Zusammenfassung und Ausblick 811 Glossar 824 Personenregister 829 Sachregister 835 |
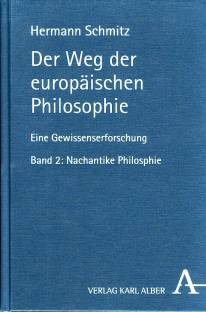
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen