|
|
|
Umschlagtext
Das Werk bietet eine kritische Sichtung der theologischen Fragestellungen in der Philosophie. Der Band behandelt die Geschichte vom Aufstieg und Verfall der Philosophischen Theologie, beginnend beim frühen griechischen Denken bis zu ihrem Ende bei Nietzsche und Heidegger. Nachdem gezeigt wurde, dass die bisherigen Bemühungen gescheitert sind, legt der Verfasser die Grundlegung einer Philosophischen Theologie vor, in der eine Auseinandersetzung mit christlichen Theologen erfolgt. Er entwickelt eine auf radikales Fragen und undogmatische Offenheit gründende Konzeption des Philosophierens, um im Schlussteil eine von seinem Ansatz her mögliche Philosophische Theologie auszuarbeiten. Mit dem vorliegenden Band liegt eines der wichtigsten Werke deutscher Sprache in der Diskussion mit Philosophischer Theologie vor.
Rezension
Diese ursprünglich 1972 erschienene Darstellung von Wilhelm Weischedel bietet eigentlich ein Doppeltes: Zum einen einen Durchgang durch die gesamte Geschichte der Philosophie unter der Fragestellung nach Gott bzw. theologischem Denken in der Philosophie. Insofern kann die Darstellung auch als Philosophiegeschichte gelten, jedenfalls im ersten Teil (das Buch wurde vormals in 2 Bänden aufgelegt, u.a. in der vergriffenen dtv-Ausgabe). Zum anderen bietet es im zweiten Teil die sehr eigenständige Positionierung des Autors mit dem Versuch, eine Philosophische Theologie im Zeitalter des Nihilismus zu begründen. Der Autor entwickelt eine existenzphilosophische Spielart einer Natürlichen Religion - und stellt sich damit (von Heidegger herkommend) gegen eine Offenbarungsreligion z.B. Karl Barthscher Prägung und grenzt sich zugleich vom Gott des Christentums ab. Radikales Fragen ist vielmehr die philosophische Existenzweise: Skeptizismus, Atheismus und Nihilismus. Der Philosoph steht zwischen Glaube und Nicht-Glaube, zwischen Sinn und Sinnlosigkeit und hält die Spannung offen. Es bleibt letztlich nur die Frage nach dem Vonwoher der Fraglichkeit, - und also keine Seins- und Substanzmetaphysik, sondern nur eine realtionale Ontologie. Das Vonwoher der Fraglichkeit ist die einzige Möglichkeit, noch von Gott zu reden. Gott ist nicht mehr das höchste Seiende oder eine Person oder ein Geist. Gott ist das Vonwoher der Fraglichkeit und damit ein Geheimnis. Das hat nichts mehr mit dem traditionellen christlichen Reden über Gott zu tun; weder lassen sich Aussagen über das Wesen Gottes machen noch ist Gott ein transzendenter Gott noch ein Gott, der sich offenbart (hat). Vielmehr ist das tiefste Wesen der Wirklichkeit deren radikale Fraglichkeit. In offenem Skeptizismus muss der Mensch immer weiterfragend der Fraglichkeit standhalten: eine existentialistische Position.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
WBG-Preis EUR 29,90 Buchhandelspreis EUR 39,90 Mit dem vorliegenden Band liegt eines der wichtigsten Werke in der Diskussion mit Philosophischer Theologie vor. Wilhelm Weischedel entwickelt eine auf radikales Fragen und undogmatische Offenheit gründende Konzeption des Philosophierens, um im Schlussteil eine von seinem Ansatz her mögliche Philosophische Theologie auszuarbeiten. Wilhelm Weischedel (1905-1975) studierte evangelische Theologie, Philosophie und Geschichte. Er lehrte als Professor der Philosophie in Tübingen und Berlin. Inhaltsverzeichnis
Erster Band
Wesen, Aufstieg und Verfall der Philosophischen Theologie Vorrede XVII EINLEITUNG BEGRIFF UND AUFGABE EINER PHILOSOPHISCHEN THEOLOGIE § 1. Die innere Problematik einer Philosophischen Theologie 1 1. Kapitel Die Philosophische Theologie als Theologie § 2. Abgrenzung der Philosophischen Theologie gegen die Religionsphilosophie 3 1. Die zweifache Bedeutung des Begriffs der Religionsphilosophie 3 2. Protestantisch-theologische Religionsphilosophie bei Emil Brunner 3 3. Katholisch-theologische Religionsphilosophie bei Heinrich Fries 5 4. Religionsphilosophie als Lehre vom religiösen Verhalten 8 § 3. Die Philosophische Theologie als Reden von Gott 11 1. Theologie als logos vom theos 11 2. Ursprung des Begriffs der Theologie im griechischen Denken 13 3. Der Begriff des theos 15 4. Der Begriff des logos 16 2. Kapitel Die Philosophische Theologie als Philosophie § 4. Die Philosophische Theologie als Metaphysik 21 § 5. Philosophieren als radikales Fragen 25 1. Philosophieren als Vollzug 25 2. Philosophieren als Fragen 26 3. Philosophieren als radikales Fragen 27 4. Das radikale Fragen als Wurzel der Metaphysik 28 5. Das radikale Fragen als Wurzel der Kritik an der Metaphysik 29 6. Die Dialektik von Frage und Antwort 30 § 6. Voraussetzungslosigkeit und innere Fraglichkeit des Philosophierens 31 1. Die Voraussetzungslosigkeit des Philosophierens 31 2. Die Selbstbezweiflung des radikalen Fragens 33 § 7. Das radikale Fragen in der Philosophischen Theologie 34 1. Der Zwiespalt in der Philosophischen Theologie 34 2. Die existentielle Bedeutung der Philosophischen Theologie 36 ERSTER TEIL DER AUFSTIEG DER PHILOSOPHISCHEN THEOLOGIE § 8. Die Aufgabe 38 1. Kapitel Die Philosophische Theologie in der Antike § 9. Die vorsokratischen Philosophen 39 1. Das theologische Wesen der griechischen Philosophie 39 2. Thaies und Anaximander 39 3. Die Entstehung der Philosophischen Theologie aus dem Mythos 40 4. Xenophanes 42 5. Parmenides 43 6. Heraklit 44 7. Empedokles 45 8. Anaxagoras 45 9. Zusammenfassung 46 § 10. Sokrates 47 § 11. Platon 1. Vollkommenheit und Unveränderlichkeit des Gottes 48 2. Gottesbeweis 49 3. Der Gott als Weltregent und Weltverfertiger 51 4. Der Gott und die Ideenwelt 52 5. Die Göttlichkeit der Seele und der Philosophie 53 § 12. Aristoteles 54 1. Die Erste Philosophie 54 2. Das erste unbewegte Bewegende 55 3. Das Göttliche als Vernunft 58 § 13. Epikureismus und Stoa 59 1. Epikureismus 59 2. Stoa 60 § 14. Neuplatonismus 63 1. Das Viele und das Eine 63 2. Negative Theologie 65 3. Der Herabstieg 67 4. Die metaphysische Erfahrung Plotins 68 2. Kapitel Die Philosophische Theologie im Zeitalter der Patristik § 15. Die Anfänge der christlichen Philosophie 69 1. Das frühe Christentum 69 2. Paulus 71 3. Tertullian 72 4. Justinus 73 § 16. Die Gnosis 76 1. Das Schicksal der Seele 76 2. Gottheit und Welt 77 3. Die Rückkehr der Seele 80 4. Die Herabkunft des Gesandten 81 5. Die Gnosis als Philosophische Theologie 81 § 17. Clemens Alexandrinus 82 1. Philosophie, Glaube und Gnosis 82 2. Gott und der Logos 85 3. Beweis und Autorität 86 4. Mystische Theologie 87 § 18. Origenes 88 1. Philosophie, Glaube und Gnosis 88 2. Die Erkenntnis Gottes und der Logos 89 3. Das theologische System 91 § 19. Dionysios Areopagita 92 1. Die Weisen der Theologie 92 2. Der mystische Weg 96 3. Christliche und Philosophische Theologie 97 § 20. Augustinus 98 1. Die Genesis der Philosophischen Theologie des Augustinus 98 2. Denken und Glauben 103 3. Gottesbeweis 106 4. Das Wesen Gottes 111 5. Verborgenheit Gottes und Aufstieg der Seele 112 6. Trinität und Analogie 113 7. Die Schöpfung 116 8. Ergebnis 118 3. Kapitel Die Philosophische Theologie im Mittelalter § 21. Die Philosophie des Mittelalters als Philosophische Theologie 118 § 22. Extreme Positionen im Streit zwischen Vernunft und Glauben 121 1. Siger von Brabant 121 2. Petrus Damiani 121 3. Bernhard von Clairvaux 122 § 23. Die Vernunft auf dem Grunde des Glaubens bei Anselm von Canterbury 122 1. Glaube und Vernunft 122 2. Die Gottesbeweise 124 § 24. Die Vernunft auf dem Grunde des Glaubens bei späteren Denkern 125 1. Bonaventura 125 2. Roger Bacon 127 § 25. Die zwiespältige Macht der Vernunft 127 1. Abälard 127 2. Alexander von Hales 129 § 26. Philosophische und theologische Theologie bei Thomas von Aquino 130 1. Vernunft und Glaube 130 2. Sacra doctrina und Theologia philosophica 131 3. Die Geschöpflichkeit als Grund der philosophischen Gewißheit 132 4. Die Vereinbarkeit von Vernunft und Glauben 134 § 27. Die Gottesbeweise bei Thomas von Aquino 135 1. Verwerfung des Gottesbeweises Anselms 135 2. Über die Möglichkeit eines Gottesbeweises 136 3. Darstellung der Gottesbeweise 137 4. Kritische Erwägungen 139 § 28. Vernunft und Glaube im späteren Mittelalter 142 1. Duns Scotus 142 2. Wilhelm von Ockham 144 § 29. Philosophische Theologie als Mystik 145 1. Johannes Scotus Eriugena 145 2. Bernhard von Clairvaux 147 3. Hugo von St. Victor 148 4. Richard von St. Victor 148 5. Bona Ventura 149 § 30. Meister Eckhart 152 1. Abgeschiedenheit und Gottgleichheit der Seele 152 2. Das Wesen Gottes 155 § 31. Nicolaus von Cues 157 1. Das Wesen Gottes 157 2. Gott und Welt 161 3. Die Erkenntnis Gottes 161 4. Kapitel Die Philosophische Theologie von Descartes bis Leibniz § 32. Die Philosophische Theologie bei Descartes 165 1. Descartes als Philosophischer Theologe 165 2. Zweifel und Selbstgewißheit 168 3. Der Gottesbeweis aus der Vorstellung von Gott 169 4. Der Gottesbeweis aus dem Begriff Gottes 174 § 33. Die Philosophische Theologie bei Spinoza 175 1. Der Gottesbegriff 175 2. Gott und Welt 178 3. Die Erkenntnis Gottes 181 § 34. Die Philosophische Theologie bei Leibniz 184 1. Vernunft und Glaube 184 2. Die Gottesbeweise 185 3. Gott und die Welt 188 5. Kapitel Die Philosophische Theologie bei Kant § 35. Metaphysik und Philosophische Theologie 191 § 36. Aufhebung der Philosophischen Theologie 194 1. Kritik am ontologischen Gottesbeweis 194 2. Kritik am kosmologischen Gottesbeweis 195 3. Kritik am physikotheologischen Gottesbeweis 198 4. Die Unmöglichkeit einer theoretischen Metaphysik und einer Philosophischen Theologie 200 5. Die positive Bedeutung des Gottesbegriffs 200 § 37. Neubegründung der Philosophischen Theologie 202 1. Der unbedingte Anspruch als Faktum 202 2. Das Postulat Gottes 203 3. Das Wesen Gottes 205 4. Die Freiheit und das Reich der Zwecke 206 5. Die moralische Voraussetzung der Philosophischen Theologie Kants 208 6. Kritische Erwägungen 211 6. Kapitel Die Philosophische Theologie bei Schleiermacher § 38. Das Wesen der Religion 213 1. Abgrenzung gegen Metaphysik und Moral 213 2. Wesensbestimmung der Religion 215 § 39. Der Gegenstand der Religion 216 1. Gott und Welt 216 2. Kritische Erwägungen 220 7. Kapitel Die Philosophische Theologie bei Fichte § 40. Die Philosophische Theologie in der „Kritik aller Offenbarung" 221 § 41. Die Philosophische Theologie im Atheismusstreit 223 1. Die Notwendigkeit der Annahme einer moralischen Weltordnung 223 2. Freiheit und übersinnliche Welt 225 3. Der Gottesbegriff 225 4. Begründung der philosophisch-theologischen Aussagen m der Erfahrung 227 $ 42. Die Gotteslehre 230 1. Die Wissenschaftslehre als Philosophische Theologie 230 2. Das Sein Gottes 231 3. Das Dasein Gottes 233 4. Das Wissen als das Dasein Gottes 234 § 43 Die Erkenntnis Gottes 239 1. Die intellektuelle Anschauung 239 2. Die Selbstnegation 241 3. Liebe, Denken und Handeln 243 4. Kritische Erwägungen 245 8. Kapitel Die Philosophische Theologie bei Schelling § 44. Das absolute Ich 245 1. Schellings Philosophie als Philosophische Theologie 245 2. Absolutheit und Freiheit im Ursprung des Ich 247 3. Das absolute Ich als ewig 250 § 45. Das Absolute, Gott und seine Geschichte 252 1. Das Absolute 252 2. Das Absolute als Gott 253 3. Das Wesen Gottes 254 4. Die Geschichte Gottes 257 § 46. Die intellektuelle Anschauung als Selbstanschauung 259 1. Die Unbeweisbarkeit des Absoluten 259 2. Absolutes Erkennen und intellektuelle Anschauung 261 3. Die ursprüngliche intellektuelle Anschauung 262 4. Die aktuelle intellektuelle Anschauung 264 § 47. Die intellektuelle Anschauung als Anschauung des Absoluten 266 1. Das Absolute als Gegenstand der intellektuellen Anschauung 266 2. Die Selbsterkenntnis Gottes im absoluten Wissen 267 § 48. Kritische Erwägungen 270 1. Die Problematik der Selbstbegründung der intellektuellen Anschauung 270 2. Die Problematik der Anschauung des Ewigen im Ich 273 3. Die Problematik der Anschauung des Absoluten: Gott und das Nichts 277 § 49. Intellektuelle Anschauung und Ekstase beim späten Schelling 281 9. Kapitel Die Philosophische Theologie bei Hegel § 50. Religionsphilosophie und Philosophische Theologie 283 § 51. Der Begriff Gottes 289 1. Das Problem 289 2. Gott als das unendliche Leben 289 3. Gott als das Absolute 290 4. Gott als die Wahrheit 293 5. Gott als der Begriff 295 6. Gott als die Idee 299 7. Gott als der absolute Geist 301 8. Gott als absolute Wirklichkeit 304 § 52. Die Ewigkeit Gottes und die Zeit 305 § 53. Hegels Philosophische Theologie und das Christentum 308 § 54. Die Aufgabe einer Explikation der philosophischen Grunderfahrung Hegels 313 § 55. Die religiöse Erhebung in den Jugendfragmenten 316 1. Das Wesen der Religion 316 2. Die Liebe und das Leben 318 3. Die Genesis der Religion 319 4. Die religiöse Erhebung 320 § 56. Die transzendentale Anschauung in den frühen Druckschriften 322 1. Das Absolute 322 2. Die Erhebung der Vernunft 323 3. Die Selbstaufhebung des Verstandes 325 4. Die transzendentale Anschauung 326 5. Die positive Rolle des Verstandes 328 § 57. Die Unzulänglichkeit des unmittelbaren Gottesbewußtseins 330 1. Der empirische Weg zur Erkenntnis Gottes 330 2. Die unmittelbare Gottesgewißheit 331 3. Kritik an der unmittelbaren Gewißheit 333 4. Unmittelbarkeit und Vermittlung 334 5. Kritik an der zeitgenössischen Religionsphilosophie 336 § 58. Die Unzulänglichkeit des Gefühls 337 § 59. Die Unzulänglichkeit der Vorstellung 340 § 60. Die Unzulänglichkeit des reflektierenden Denkens 342 1. Das Denken als Reflexion 342 2. Die Problematik von Endlichkeit und Unendlichkeit 343 3. Die Selbstbehauptung des Verstandes 346 § 61. Der spekulative Weg des Denkens 349 § 62. Die Dialektik von Endlichkeit und Unendlichkeit 351 1. Die gegenseitige Bezogenheit von Endlichkeit und Unendlichkeit 351 2. Die gegenseitige Setzung des Endlichen und Unendlichen 353 § 63. Die denkende Erhebung zu Gott 356 1. Das Wesen der Erhebung 356 2. Die Erhebung über das Endliche 357 3. Das Ziel der Erhebung 358 § 64. Vorformen der denkenden Erhebung 360 1. Die Andacht 360 2. Der Kultus 361 3. Der Glaube 362 § 65. Die Gottesbeweise als Weisen der denkenden Erhebung 363 1. Abweisung des aufklärerischen Gottesbegriffes 363 2. Auseinandersetzung mit Kant 364 3. Die Gottesbeweise als denkende Erhebung zu Gott 365 4. Die beiden Grundformen der Gottesbeweise 366 § 66. Der kosmologische Gottesbeweis 366 1. Der traditionelle Beweis 366 2. Die Grunderfahrung im kosmologischen Beweis 368 3. Kritik des traditionellen Beweises 372 § 67. Der ontologische Gottesbeweis 374 § 68. Die Erhebung als Erfahrung 376 ZWEITER TEIL DER VERFALL DER PHILOSOPHISCHEN THEOLOGIE 1. Kapitel Hegel und die Problematik der Philosophischen Theologie § 69. Ansätze zum Verfall in der Philosophischen Theologie Hegels 378 1. Die Problematik 378 2. Das Problem der Zufälligkeit 379 3. Das Faktum der Religionen als Ansatzpunkt einer Zersetzung 382 4. Das Faktum der Gemeinde als Ansatzpunkt einer Zersetzung 383 5. Das Verhältnis von Gottesbewußtsein und Selbstbewußtsein als Ansatzpunkt einer Zersetzung 384 6. Die Problematik des Wortes „Gott" 386 § 70. Die Hegeldeutung Bruno Bauers 387 2. Kapitel Die anthropologische Überwindung der Philosophischen Theologie bei Feuerbach § 71. Auseinandersetzung mit Hegel 390 1. Positive Bewertung Hegels 390 2. Kritik an Hegel 391 § 72. Die anthropologische Grundlegung der Philosophie 392 § 73. Kritik an Religion und Philosophischer Theologie 396 1. Deutung der Religion 396 2. Deutung der Philosophischen Theologie 398 § 74. Die Problematik des Ansatzes bei der Unendlichkeit 399 1. Die Unendlichkeit der Gattung 399 2. Die Unendlichkeit der Natur 401 § 75. Der Atheismus 403 1. Das Wesen des Atheismus 403 2. Geschichtsphilosophische Begründung des Atheismus 404 3. Psychologische Begründung des Atheismus 406 3. Kapitel Die sozialphilosophische Überwindung der Philosophischen Theologie bei Marx § 76. Auseinandersetzung mit Feuerbach 410 1. Anknüpfung an Feuerbach 410 2. Absetzung von Feuerbach 411 § 77. Auseinandersetzung mit Hegel 414 1. Anknüpfung an Hegel 414 2. Kritik an Hegels transzendentalphilosophischem Ansatz 415 3. Kritik an Hegels philosophisch-theologischem Ansatz 418 § 78. Die anthropologische Konstitution des Menschen 422 1. Mensch, Geschichte und Gesellschaft 422 2. Die Entfremdung und ihre Aufhebung 425 § 79. Verwirklichung und Verwandlung der Philosophie 427 4. Kapitel Die nihilistische Überwindung der Philosophischen Theologie bei Nietzsche § 80. Verwerfung der Metaphysik 429 1. Die Metaphysik im Blickpunkt Nietzsches 429 2. Die erkenntnistheoretische Begründung der Verwerfung der Metaphysik 431 3. Die geschichtliche Begründung der Verwerfung der Metaphysik 432 4. Die psychologische Begründung der Verwerfung der Metaphysik 433 § 81. Atheismus und Tod Gottes 434 1. Die atheistische These 434 2. Die psychologische Begründung des Atheismus 435 3. Die geschichtsphilosophische Begründung des Atheismus 436 § 82. Der Nihilismus 439 1. Das Wesen des Nihilismus 439 2. Die Geschichtlichkeit des Nihilismus 440 3. Die Selbstentwertung der Werte 441 4. Der christliche Ursprung des Nihilismus 444 5. Der gegenwärtige Nihilismus 445 § 83. Die Überwindung des Nihilismus 446 1. Die Aufgabe der Überwindung 446 2. Die Umwertung aller Werte 447 3. Die ewige Wiederkehr 448 § 84. Die neue Metaphysik Nietzsches 452 1. Die Absolutsetzung des Lebens 452 2. Der Wille zur Macht 454 3. Der Übermensch 455 4. Die Möglichkeit neuer Götter 456 5. Kapitel Die seinsgeschichtliche Überwindung der Philosophischen Theologie bei Heidegger § 85. Kritik an Metaphysik und Philosophischer Theologie 458 1. Das Wesen der Metaphysik 458 2. Kritik an der Metaphysik 459 § 86. Der Begriff des Seins 462 1. Vorläufige Explikation des Seinsbegriffes 462 2. Das Verhältnis von Sein und Seiendem 463 3. Die Spontaneität des Seins 464 4. Das Sein und der Mensch 465 § 87. Seinsgeschichte und Metaphysik 466 1. Kritik an der neuzeitlichen Metaphysik 466 2. Seinsgeschichte und Seinsgeschick 467 3. Entbergung und Verbergung des Seins 469 § 88. Der seinsgeschichtliche Begriff des Nihilismus 470 § 89. Die Überwindung der Metaphysik im Seinsdenken 473 1. Die Aufgabe einer Überwindung der Metaphysik 473 2. Das Denken an das Sein 474 § 90. Die Erfahrung des Seins 476 1. Der Vollzug der Seinserfahrung 476 2. Das Sein als Ursprung der Seinserfahrung 478 § 91. Die Angst als Erfahrung des Nichts 479 1. Angst und Nichts 479 2. Die Angst als philosophische Grunderfahrung 480 3. Die Erfahrung der Angst als Erfahrung der Fraglichkeit 481 § 92. Die Kehre im Denken Heideggers 482 1. Die Kehre zum nichtenden Nichts 482 2. Die Kehre zum Sein 482 § 93. Weisen der Erfahrung des Seins 484 1. Das Seinsverständnis 484 2. Die Seinsvergessenheit 484 3. Der Sprung in das Sein 486 § 94. Fragen und Sagen 487 1. Das Fragen 487 2. Das Sagen 488 § 95. Heideggers seinsgeschichtliche Theologie 489 1. Auseinandersetzung mit dem Gott der Philosophen 489 2. Auseinandersetzung mit dem christlichen Gottesbegriff 490 3. Das Ausbleiben des Gottes 491 4. Neue Ankunft der Götter 492 6. Kapitel Abschließende Bemerkungen § 96. Rückblick 494 § 97. Ausblick 496 Personenregister 497 Sachregister 500 Zweiter Band Abgrenzung und Grundlegung DRITTER TEIL AUSEINANDERSETZUNGEN § 98. Die Aufgabe des zweiten Bandes 1 1. Kapitel Die theologische Bestreitung der Möglichkeit einer Philosophischen Theologie § 99. Die Streitthese 2 § 100. Barths Auseinandersetzung mit der Philosophischen Theologie 4 1. Verwerfung der natürlichen Theologie 4 2. Scheinbare Abmilderung des Kampfes 8 3. Philosophie und Theologie 9 4. Die Wirklichkeit Gottes und der Glaube 11 § 101. Gollwitzers Auseinandersetzung mit der Philosophischen Theologie 16 1. Abwertung der Philosophie 16 2. Bewahrheitung des Glaubens 20 § 102. Bultmanns Auseinandersetzung mit der Philosophischen Theologie 24 1. Abweisung der natürlichen Theologie 24 2. Das Vorverständnis als Basis für eine Philosophische Theologie 26 3. Die Religion als Basis für eine Philosophische Theologie 28 4. Die Philosophie als Basis für eine Philosophische Theologie 29 § 103. Ebelings Auseinandersetzung mit der Philosophischen Theologie 33 1. Fraglichkeit der Wirklichkeit und Atheismus 33 2. Glaube und Vernunft 34 3. Das Problem der Tradition 35 4. Unmöglichkeit einer neutralen Aussage über Gott 38 5. Priorität des Glaubens 41 § 104. Vernunft und Glaube nach katholischer Auffassung 42 1. Natürliche Theologie 42 2. Der Begriff des Glaubens 46 3. Bewahrheitung des Glaubens 47 § 105. Glauben und Philosophieren 51 1. Die inhaltlichen Zumutungen des Glaubens 51 2. Die formale Zumutung des Glaubens 55 3. Philosophieren und Glauben 57 2. Kapitel Zeitgenössische Ansätze zu einer Philosophischen Theologie § 106. Das Problem des Ansatzes 59 § 107. Der fundamentaltheologische Ansatz bei Rahner 60 1. Religionsphilosophie als Philosophische Theologie, als Fundamentaltheologie und als Metaphysische Anthropologie 60 2. Metaphysische Grundlegung 61 3. Metaphysische Anthropologie und Philosophische Theologie 63 4. Freiheit Gottes, Schöpfung und Offenbarung 68 5. Offenbarung in Wort und Geschichte 71 6. Der offenbarungstheologische Charakter der Religionsphilosophie Rahners 74 § 108. Die Erneuerung der natürlichen Theologie bei Pannenberg 75 1. Begründung einer natürlichen Theologie in der Anthropologie 75 2. Begründung einer natürlichen Theologie im Gedanken der Sinnhaftigkeit 79 3. Begründung einer natürlichen Theologie in der Geschichte 81 § 109. Die Religionsphilosophie beim frühen Tillich 87 1. Das Problem der Religionsphilosophie 87 2. Das Unbedingte in der Philosophie 88 3. Das Unbedingte in der Religion 90 4. Die Gewißheit des Unbedingten 91 § 110. Die Philosophische Theologie beim späteren Tillich 93 1. Philosophische und kerygmatische Theologie 93 2. Philosophie und philosophische Grunderfahrung 94 3. Philosophie als Philosophische Theologie 95 4. Das Sein als Gott 97 5. Zweifel und Wahrheit 99 6. Sinnlosigkeit und Macht des Seins 100 7. Der absolute Glaube und der Gott über Gott 102 8. Zweifel, Sinnlosigkeit und Glaube 103 9. Der kerygmatische Charakter der Philosophie 104 10. Philosophie und Glaube 106 11. Vernunft und Offenbarung 108 12. Die christliche Aufgabe der Philosophischen Theologie 110 § 111. Der phänomenologische Ansatz bei Scheler 111 1. Die personalistische natürliche Theologie 111 2. Gründung der Philosophischen Theologie in der Metaphysik 114 3. Gründung der Philosophischen Theologie in den religiösen Akten 117 4. Gründung der Philosophischen Theologie in der Anthropologie 123 § 112. Der existenzphilosophische Ansatz bei Jaspers 126 1. Das Problem 126 2. Erfahrung der Fraglichkeit 128 3. Grenze und Transzendieren 130 4. Erfahrung der Freiheit 131 5. Erfahrung der Transzendenz 134 6. Der philosophische Glaube 136 § 113. Der ontologische Ansatz bei Krüger 140 1. Die Situation der Gegenwart 140 2. Die ontische Wahrheit 142 3. Die metaphysische Grunderfahrung 145 4. Entwurf einer Philosophischen Theologie 147 5. Kritische Bemerkungen 150 VIERTER TEIL PHILOSOPHIEREN UND SINNPROBLEMATIK 1. Kapitel Aspekte des Philosophierens § 114. Das radikale Fragen als philosophischer Ausgangspunkt 153 1. Rückblick 153 2. Philosophieren als radikales Fragen 154 § 115. Philosophieren als offener Skeptizismus 155 § 116. Philosophieren als offener Atheismus 156 1. Der Begriff des Atheismus 156 2. Der eingeschränkte Atheismus 157 3. Der extreme Atheismus 158 § 117. Philosophieren als offener Nihilismus 160 1. Der Begriff des Nihilismus 160 2. Die Wahrheitsproblematik im Nihilismus 161 3. Der ontologische Nihilismus 162 4. Der noologische Nihilismus 164 2. Kapitel Das Philosophieren zwischen Sinngewißheit und Nihilismus § 118. Der formale Begriff des Sinnes 165 1. Sinn als Verstehbarkeit 165 2. Die gemeinte Objektivität des Sinnes 166 3. Die Verweisung des Sinnhaften auf ein Sinngebendes 167 4. Sinn als rechtfertigender und fraglosmachender Grund 168 5. Die Sinnkette 169 6. Definition des Sinnes 170 § 119. Das Problem eines unbedingten Sinnes 170 § 120. Die Unhaltbarkeit der unmittelbaren Sinngewißheit 173 § 121. Unerweisbarkeit und Unwiderlegbarkeit des dogmatischen Nihilismus 174 1. Die Unerweisbarkeit 174 2. Die Unwiderlegbarkeit 175 3. Die nihilistische Existenz 177 § 122. Der Grundentschluß zum Philosophieren 178 1. Die Existenz im radikalen Fragen 178 2. Das Wesen des philosophischen Grundentschlusses 180 3. Grundentschluß und Selbstmord 182 FÜNFTER TEIL GRUNDLEGUNG DER PHILOSOPHISCHEN THEOLOGIE 1. Kapitel Die philosophische Grunderfahrung § 123. Die Aufgabe der Entfaltung des philosophischen Grundentschlusses 184 § 124. Das radikale Fragen und die philosophische Grunderfahrung 185 1. Das Fragen als Erfahrung 185 2. Die radikale Fraglichkeit 185 3. Die philosophische Grunderfahrung und die Freiheit 188 § 125. Erfahrungen der Fraglichkeit 189 § 126. Allgemeine Charakteristik der philosophischen Grunderfahrung 194 1. Die Grunderfahrung als Erfahrung 194 2. Die Unmittelbarkeit der Grunderfahrung 194 3. Die Grundhaftigkeit der Grunderfahrung 198 4. Selbstberichtigung 200 5. Die Grunderfahrung als schwebende Erfahrung der Fraglichkeit von Sein und Sinn 201 § 127. Wahrheit und Wirklichkeit der philosophischen Grunderfahrung 203 1. Wahrheit und Wirklichkeit der Erfahrung 203 2. Die Wirklichkeit als Fraglichkeit 205 2. Kapitel Gott als das Vonwoher der Fraglichkeit § 128. Das Vonwoher der Fraglichkeit 206 1. Die Bedingung der Möglichkeit der Fraglichkeit 206 2. Grund, Ursprung, Herkunft, Vonwoher 208 § 129. Die Frage nach dem Vonwoher als Spekulation 211 § 130. Heideggers Abweisung des Begriffs des Grundes 213 1. Die Auslegung des Satzes vom Grund 213 2. Grund und Sein 214 3. Sein und Vonwoher 216 § 131. Das Vonwoher als Gott 216 3. Kapitel Das Wesen des Vonwoher § 132. Die philosophisch-theologische Sprache 218 1. Sprache und Schweigen 218 2. Die schwebende Sprache 220 3. Analogie und Dialektik 220 § 133. Das Vonwoher als Geheimnis 223 1. Das Wesen des Geheimnisses 223 2. Geheimnis und Vonwoher 225 § 134. Das Vonwoher als deus absconditus 227 § 135. Das Vonwoher als Vorgehen 228 § 136. Das Vonwoher als Mächtigkeit 229 § 137. Das Vorgehen des Vonwoher als Erschüttern, als Im-Sein-halten und als Erwirken des Schwebens 230 1. Das Vorgehen des Vonwoher als Erschüttern 230 2. Das Vorgehen des Vonwoher als Im-Sein-halten 231 3. Das Vorgehen des Vonwoher als Erwirken des Schwebens 233 § 138. Das Vonwoher als Sein, als Nichtigkeit und als Schweben 234 1. Das Vonwoher als Sein 234 2. Das Vonwoher als Nichtigkeit 235 3. Das Vonwoher als Schweben 236 4. Der Gott der Philosophen 237 § 139. Das Vonwoher als unbedingte Sinnermöglichung und Sinn-abgründigkeit 238 § 140. Ewigkeit oder Zeitlichkeit des Vonwoher 239 4. Kapitel Abgrenzungen § 141. Abgrenzung gegen den Gottesbegriff der christlichen Theologie 242 § 142. Abgrenzung gegen Hegels Gottesbegriff 246 1. Obereinstimmungen 246 2. Unterschiede 247 § 143. Abgrenzung gegen Schellings Gottesbegriff 249 1. Übereinstimmungen 249 2. Unterschiede 249 5. Kapitel Folgerungen § 144. Der philosophisch-theologische Aspekt auf die Weltwirklichkeit 250 § 145. Der philosophisch-theologische Aspekt auf den Menschen 253 § 146. Die philosophisch-theologische Haltung 255 1. Offenheit 255 2. Abschied 256 Personenregister 259 Sachregister 261 |
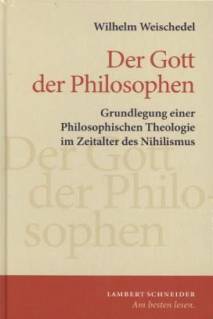
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen