|
|
|
Umschlagtext
Der Mensch im Mittelpunkt
Krankheiten können den Menschen in eine existenzielle Krise stürzen. Die moderne Medizin reagiert darauf mit Naturwissenschaft und perfekter Technik, aber sie lässt den Menschen in seiner Lebenskrise oft allein. Giovanni Maio macht die Einseitigkeit einer naturwissenschaftlich orientierten Medizin deutlich und entwirft eine Ethik in der Medizin, die auf die Kraft der Zuwendung und der Begegnung setzt. Ein überfälliger Aufruf zu einer neuen Medizin der Zwischenmenschlichkeit in einer überarbeiteten Ausgabe. Giovanni Maio, Prof. Dr., geb. 1964, Studium der Medizin und Philosophie in Freiburg, Straßburg und Hagen. Seit 2005 Professor für Bioethik, seit 2006 Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, und Geschäftsführender Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin. Er berät die Deutsche Bischofskonferenz wie auch die Bundesregierung und die Bundesärztekammer. Rezension
Dieses Buch liegt nun in einer überarbeiteten Neuausgabe vor; es ist erwachsen aus einer langjährigen Beschäftigung mit den Fehlentwicklungen der modernen Medizin. Das letzte Kapitel dieses Buches hat die Überschrift: "Ohne Zuwendung ist alles nichts." Das ist zugleich die Hauptthese, mit der eine rein naturwissenschaftlich und technich perfekte Medizin kritisiert wird zugunsten einer "Medizin der Zuwendung" mit dem Menschen im Mittelpunkt, die der Autor seit langem vertritt und in verschiedenen Veröffentlichungen dafür eintritt. Giovanni Maio macht die Einseitigkeit einer naturwissenschaftlich orientierten Medizin deutlich und entwirft eine Ethik in der Medizin, die auf die Kraft der Zuwendung und der Begegnung setzt. In der Neuausgabe war dem Autor besonders wichtig eine Erweiterung des Spektrums der phänomenologisch aufgearbeiteten Krankheiten, da ich aufzeigen wollte, dass sich mit dem Krankwerden eben nicht nur das innere Bewusstsein verändert, sondern dass die Krankheit manifeste Auswirkungen auch auf äußere Prozesse hat, sichtbare Symptome, die wiederum das eigene Bewusstsein und die Selbstwahrnehmung von Grund auf verändern können.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Das Hauptwerk des Pioniers der »Medizin der Zuwendung« Überarbeitete und aktualisierte Ausgabe Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur 3. Auflage 9
Vorwort zur 1. Auflage 11 I. Moderne Medizin – oder wenn das Verstehen des Patienten zur Nebensache wird 15 Medizin als Industriebetrieb? 17 Gute Medizin sucht nach singulären Lösungen 19 Gute Medizin braucht behutsames Abwägen 20 Reflexion und Synthese 21 Erfahrung und Urteilskraft 23 Gute Medizin zwischen einer Kunst des Machens und einer Kunst des Verstehens 26 II. Eine kleine Phänomenologie des Krankseins – Beispiele aus der Praxis 29 1. Chronischer Schmerz – der widrige Stachel als Bewältigungsaufgabe 31 Der Stachel 31 Das Getroffenwerden 32 Vereinsamung 34 Die subjektive Erfahrung in einer Medizin, die auf Objektivierbarkeit setzt 36 Der Schmerzpatient als Gegenpol zum Unternehmer seiner selbst 38 Schmerzen haben als persönliches Versagen? 40 Gefangen und doch frei – der Schmerz als Bewältigungsaufgabe 41 2. Krebs – das Herausgeworfensein aus der Normalität 45 Diagnose Krebs als abrupte Unterbrechung der Normalität 46 Verlust der Kontrolle über das eigene Leben 48 Verlust der leiblichen Geborgenheit 49 Abschied von der Verlässlichkeit der Zukunft 53 Metamorphose 55 Erkennen verborgener Ressourcen 60 Die Neuerstellung von Normalität 62 3. Parkinson – die Entfremdung vom eigenen Körper 67 Das Fremdwerden des eigenen Körpers 67 Die Unüberwindlichkeit des Raumes 70 Das Stehenbleiben der Zeit 71 Herausfallen aus dem Selbstverständlichen 72 Weckruf für die Gesunden 75 4. Demenz – die fortbestehende Identität in neuer Form 78 Der verstellte Zugang zur eigenen Geschichte 80 Der Schleier der Unvertrautheit 86 Die Scham, andere zu enttäuschen 88 Die Fähigkeit zur Resonanz 89 Leben im Bezogensein 91 Das leibliche Ich 93 Die durch Beziehung gestiftete Identität 95 5. Der sterbende Mensch – Leben im Zeichen der Angewiesenheit 100 Autonomie als kreativer Umgang mit der Angewiesenheit 101 Auch der schwerkranke Mensch hat Potenziale 104 Der fehlende Glaube an die Solidarität der anderen 105 Sozial bestätigte Wertlosigkeit des Lebens 106 Vermittlung von Lebensbejahung als soziale Aufgabe 107 Der assistierte Suizid als implizite Entpflichtung der Gesellschaft 109 Privatisierung eines gesamtgesellschaftlichen Defizits 110 Für eine Kultur der Anerkennung und Reintegration Schwerkranker in die Gesellschaft 115 III. Wege der Bewältigung 121 6. Annehmen lernen – das gute Leben als Kunst des Sich-Einrichtens 122 Was bedeutet Schicksal? 123 Wir finden Gegebenes vor 126 Leben heißt dem Widerfahrnis ausgesetzt sein 128 Die moderne Unfähigkeit, das Gegebene anzunehmen 130 Schicksal als Aufgabe 132 Freiheit 134 Vom Wert der Selbstbejahung 137 7. Vertrauen – die gemeinschaftsstiftende Kraft 139 Vertrauen als atmosphärischer Eindruck 141 Entproblematisierung des Nichtwissens 144 Vertrauen als akzeptierte Verwundbarkeit 145 Das Einräumen von Freiheit 146 Konstituierung einer Beziehung 148 Vertrauen als Treueerwartung 150 Vertrauen als Verpflichtung zur Gegenseitigkeit 152 Vertrauen als gemeinschaftsstiftende Kraft 154 Was bedeutet das für den kranken Menschen? 155 Schlussfolgerungen für die Medizin 156 8. Hoffen – das Erschließen von Zukunft im Moment der Bedrängnis 160 Hoffnung als realistischer Zukunftsbezug 162 Anerkenntnis der Grenze der eigenen Verfügungsgewalt 164 Das Nicht-Fixiertsein 166 Geduld 169 Hoffnung als Impuls zum Handeln 171 Anerkenntnis der eigenen Vulnerabilität 172 Vertrauen und Sinnverstehen 174 Alles Hoffen ist Gemeinschaft 176 9. Den kranken Menschen verstehen 182 Die Bedeutsamkeit des Verstehens am Beispiel Schizophrenie 183 Verstehen heißt den anderen sehen 186 Hineindenken aus der Distanz 189 Das Punktuelle in das Ganze zurückholen 190 Sich selbst infrage stellen 193 Verweilen können 196 Verstehen heißt das Wohin erkennen 197 Schlussfolgerungen für die Medizin 199 IV. Ohne Zuwendung ist alles nichts 203 Begegnung als Grundlage der Heilung 205 Die Zweckrationalität überwinden 207 Anerkennen 208 Zuwendung wertet auf 211 Zuwendung verwandelt 212 Die Bedeutung des Gesprächs 213 Die Bedeutung des Zuhörens 215 Medizin als Verbindung von Sachlichkeit und Zwischenmenschlichkeit 220 Anmerkungen 225 Personenverzeichnis 231 Stichwortverzeichnis 235 |
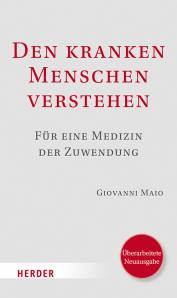
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen