|
|
|
Rezension
Chemie für die Sekundarstufe II ist ein Lehrwerk mit Tradition, das von Wilhelm Flörke begründet wurde, und in verschiedenen Ausgaben erschienen ist. Die vorliegende Neubearbeitung aus dem Jahr 2000 zeichnet sich durch einen übersichtlichen und klar strukturierten Aufbau aus. Alle relevanten Themen der Oberstufe werden abgehandelt. Zahlreiche Schüler- und Lehrerversuche ermöglichen einen lebendigen und anschaulichen Einstieg in ein neues Thema. Bei einigen Lehrerversuchen werden sehr gefährliche/giftige Substanzen verwendet bzw. entstehen wie z.B. Nitrobenzol im Lehrerversuch 1 Seite 240.
Zahlreiche Abbildungen, Graphen, Tabellen und Schaubilder illustrieren den Text und tragen erheblich zum Verständnis der Ausführungen bei. Das Buch enthält jedoch, entgegen dem aktuellen Trend, keine Photos. Ein ernsthaftes Interesse am Fach Chemie wird vorausgesetzt. Die Ausführungen sind straff und flüssig geschrieben und verlieren sich nicht in Nebensächlichkeiten. Die Aufgaben zu de jeweiligen Kapiteln und Abschnitten ermöglichen ein Sichern und Vertiefen des Stoffes und können als Lernzielkontrolle genutzt werden. „In den meisten Fällen wird nur eine Reorganisation des behandelten Stoffes erwartet“ (S. VI). Einige Aufgaben greifen interessante Details auf, nach denen interessierte Schüler oft auch selbst fragen. So geht z.B. Aufgabe 1 auf Seite 236 auf den Unterschied zwischen berechneter und experimentell ermittelter Hydrierungsenergie von 1,3-Cyclohexadien ein (Stabilisierung durch Mesomerie). Hilfreich für das Verständnis sind die Rechenbeispiele sowie mathematischen Hinweise besonders in den Kapiteln vier bis sechs: Verlauf chemischer Reaktionen, chemisches Gleichgewicht und Säure-Base-Gleichgewichte. 88 Info-Texte informieren vertieft über aktuelle und fachwissenschaftliche Fragen zu bestimmten Themen. Das Namen- und Sachwortverzeichnis ermöglicht eine rasche Orientierung. Fazit: Sorgfältig ausgearbeitetes und übersichtlich strukturiertes Lehrwerk für den Chemieunterricht in der Oberstufe. C. Bierstedt, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
• diese einbändige Ausgabe für Leistungskurse enthält in 19 in sich abgeschlossenen Kapiteln die komplette Chemie für die Oberstufe • die Konzeption des Buches stellt das Experiment in den Vordergrund und leitet aus experimentellen Ergebnissen das Grundlegende ab • ein Lösungsband ist in Vorbereitung Inhaltsverzeichnis
1 ATOMBAU (ATOMMODELLE) – PERIODENSYSTEM 1
1.1 Der Modellcharakter der Vorstellungen vom Atom 2 1.2 Von der Atomhypothese zum differenzierten Atommodell 2 1.2.1 Das Dalton’sche Atommodell 2 1.2.2 Die Bausteine des Atoms 3 1.2.3 Das Planetenmodell von Rutherford 4 1.2.4 Der Atomkern 4 1.2.5 Die Elektronenspektren der Elemente 5 1.2.6 Das Bohr’sche Atommodell 6 1.2.7 Die Heisenberg’sche Unschärferelation 7 1.2.8 Das Schalenmodell 7 1.3 Die Elektronenkonfiguration der Atome 8 1.3.1 Das Prinzip der niedrigsten Energie 8 1.3.2 Unterschalen 9 Infotext: Die Quantenzahlen 10 1.3.3 Hund’sche Regel und Paili-Prinzip 11 1.3.4 Stabilitätsregeln 11 1.3.5 Die energetische Lage der Orbitale 12 1.4 Die periodischen Eigenschaften der Elemente 13 1.4.1 Das Periodensystem 13 1.4.2 Elektronegativität 14 1.4.3 Weitere periodische Eigenschaften 14 1.5 Das wellenmechanische Atommodell 15 2 CHEMISCHE BINDUNGEN 19 2.1 Bindungstypen 20 2.1.1 Die chemische Bindung – eine Vielfalt von Wechselwirkungen 20 2.1.2 Elektronenpaarbindung und Edelgaskonfiguration 20 2.1.3 Die Atombindung 22 2.1.4 Polarisierte Atombindung und Dipolmoleküle 26 2.1.5 Ionenbindung 27 Infotext: Das Metallbindungs-Modell, ein System von Energiebändern 31 2.1.6 Bindungen zwischen den Molekülen 33 2.2 Bindungsmodelle erklären Eigenschaften – Silicium und Silicium-Sauerstoff-Verbindungen 35 2.2.1 Silicate sind natürliche Polymere 35 2.2.2 Silicone – die anorganischen Kunststoffe 37 2.2.3 Silicium – ein Grundstoff moderner Technik 38 Infotext: Fotovoltaik – elektrischer Strom aus Sonnenlicht 40 3 ENERGIEUMSATZ BEI CHEMISCHEN REAKTIONEN 41 3.1 Allgemeine Energiebetrachtungen 42 3.2 Innere Energie 42 3.3 Enthalpie 43 3.3.1 Volumenarbeit 43 Infotext: Ideale Gase 43 3.3.2 Enthalpiedefinition 44 3.4 Messung von Energien und Enthalpien 44 3.5 Enthalpien physikalischer Prozesse und Reaktionsenthalpien 46 3.5.1 Beispiele von Enthalpieänderungen bei physikalischen Prozessen 46 3.5.2 Reaktionsenthalpien 47 3.5.3 Der Satz von Hess 48 3.6 Standartbildungsenthalpie, Bindungsenergie 49 3.7 Enthalpie von Nahrungsmitteln und Brennstoffen 50 4 VERLAUF CHEMISCHER REAKTIONEN 51 4.1 Die Reaktionsgeschwindigkeit 52 4.1.1 Allgemeine Einflüsse 52 4.1.2 Definition und Messung der Reaktionsgeschwindigkeit 53 Infotext: Methoden der Konzentrationsmessung 53 4.2 Einfluss der Konzentration auf die Reaktionsgeschwindigkeit 54 4.2.1 Reaktionen 1. Ordnung 54 Infotext: Herleitung der mathematischen Formeln 55 4.2.2 Reaktionen 2. Ordnung 56 Infotext: Mathematische Behandlung von Reaktionen 2. Ordnung 57 4.3 Modellvorstellungen von chemischen Reaktionen 58 4.3.1 Konzentrationseinfluss 58 4.3.2 Temperatureinfluss 58 4.4 Messung der Aktivierungsenergie 60 4.5 Katalysatoren 62 4.5.1 Allgemeine Wirkung von Katalysatoren 62 4.5.2 Homogene und heterogene Katalyse 63 4.5.3 Der Autoabgas-Katalysator 64 5 DAS CHEMISCHE GLEICHGEWICHT 67 5.1 Umkehrbare Reaktionen 68 5.2 Physikalische Gleichgewichte: Das Prinzip vom Zwang 69 5.3 Chemisches Gleichgewicht: Beschreibung durch das Massenwirkungsgesetz 70 Infotext: Rechenbeispiel 73 5.4 Die Beeinflussung der Gleichgewichtslage 74 5.4.1 Konzentrationseinfluss 74 Infotext: Rechenbeispiel 75 5.4.2 Der Druckeinfluss 76 5.4.3 Der Temperatureinfluss 77 Infotext: Herleitung von G1 79 5.5 Katalysatorwirkung beim Gleichgewicht 79 5.6 Düngemittel aus der Luft – Das Haber-Bosch-Verfahren 79 Infotext: Pflanzenernährung und Düngung – Justus von Liebig und das Problem der Welternährung 79 5.6.1 Ammoniak als Rohstoff 81 Infotext: Vom Ammoniak zur Salpetersäure – das Ostwald-Verfahren 82 5.7 Lösungsgleichgewichte 82 5.7.1 Temperaturabhängigkeit der Löslichkeit 82 5.7.2 Das Löslichkeitsprodukt 83 6 SÄURE-BASE-GLEICHGEWICHTE 85 6.1 Säure/Base-Definition 86 6.2 Protolysegleichgewichte 87 6.2.1 Das Ionenprodukt des Wassers. Der pH-Wert 87 6.2.2 Starke und schwache Säuren 89 6.2.3 Säurekonstante und Basenkonstante 90 Infotext: Rechenbeispiele für pKs und pKb 92 6.2.4 Berechnung von pH-Werten 92 6.3 Besondere Säure-Base-Gleichgewichte 94 6.3.1 Protolyse von Salzen, Hydrolyse 94 Infotext: Berechnung von pH-Werten für Salzlösungen 94 6.3.2 Pufferlösungen 95 6.4 Titration 96 6.4.1 Säure-Base-Titrationen 96 6.4.2 Indikatoren 98 Infotext: Natürliche/synthetische Indikatoren 100 7 REDOXREAKTIONEN/ELEKTROCHEMIE 101 7.1 Redoxreaktionen als Elektronenübergänge 102 7.2 Oxidationszahlen und Redoxgleichungen 104 7.3 Die Redoxreihe 104 7.4 Galvanische Elemente 105 7.5 Die Erzeugung der Spannung in galvanischen Zellen 107 7.6 Konzentrationszellen 108 7.7 Die elektrochemische Spannungsreihe 108 7.8 Die Nernst´sche Gleichung 111 Infotext: Messung des pH–Werts 113 Infotext: Mit der Nernst’schen Gleichung kann man Gleichgewichtskonstanten berechnen 114 7.9 Korrosion 114 7.10 Elektrolysen 117 7.10 1 Elektrolysen sind erzwungene Redoxreaktionen 117 7.10.2 Zersetzungsspannung und Abscheidungspotentiale 118 Infotext: Metalle werden elektrolytisch veredelt 120 7.10.3 Faraday’sche Gesetze 121 7.11 Anwendung der Redoxreaktionen zur elektrochemischen stromerzeugung: Batterien, Akkumulatoren, Brennstoffzellen 122 7.11.1 Batterien (Primärelemente) 122 7.11.2 Akkumulatoren (Sekundärelemente) 124 Info-Text: Wohin mit verbrauchten Batterien und Akkumulatoren? 126 7.11.3 Brennstoffzellen 127 Infotext: Galvanische Zellen können Arbeit Leisten 128 7.12 Die Alkalichlorid-Elektrolyse – ein bedeutender Wirtschaftsfaktor 128 Infotext: Wozu braucht man Natronlauge und Chlor? 130 7.13 Redoxreaktionen liefern Metalle 130 7.13.1 Vom Erz zum Stahl: Eisen in Geschichte und Technik 130 7.13.2 Das Aluminium – ein Leichtgewicht mit großer Bedeutung 135 Infotext: Aluminium-Recycling - Schonung der Umwelt oder geschickter Schachzug der Industrie? 138 7.14 Redoxprozesse als Grundlage des Lebens 140 8 TRIEBKRAFT CHEMISCHER REAKTIONEN 141 8.1 Bedeutung der Reaktionsenthalpie 142 8.2 Entropie 142 Infotext: Modellvorstellungen zur Entropie 143 Infotext: Osmose 143 Infotext: Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik 145 8.3 Die Freie Enthalpie 145 8.3.1 Definition und Berechnung der Freien Enthalpie 145 8.3.2 Anwendung der Gibbs-Helmholtz-Gleichung 146 8.3.3 Freie Reaktions-Enthalpie und Nutzarbeit 148 8.3.4 Freie Enthalpie bei Gleichgewichten 149 9 KOHLENWASSERSTOFFE UND HALOGENDERIVATE 151 Infotext: Organische Chemie – die Chemie der Kohlenstoffverbindungen 152 Infotext: So kann man die Elemente in organischen Verbindungen qualitativ nachweisen 152 9.1 Gesättigte Kohlenwasserstoffe 153 9.1.1 Das Methan; Zusammensetzung und Vorkommen 154 9.1.2 Molekülgeometrie und Molekülmodelle 155 9.1.3 Bindungsverhältnisse im Methanmolekül 156 9.1.4 Homologe Reihe der Alkane 156 9.1.5 Isomerie bei Alkanen 158 9.1.6 Nomenklatur der Alkane 160 9.1.7 Energie durch Verbrennung von Alkanen 160 Infotext: Wie gefährlich sind brennbare Stoffe? 161 Infotext: Der Treibhauseffekt zwei Seiten einer Medaille 163 9.1.8 Cycloalkane - Kohlenwasserstoffe mit Ringstruktur 166 9.2 Halogenalkane – Abkömmlinge gesättigter Kohlenwasserstoffe 167 9.2.1 Halogene reagieren mit gesättigten Kohlenwasserstoffen durch Substitution 167 9.2.2 Reaktionsmechanismus der Chlorierung von Methan 168 Infotext: Eigenschaften und Verwendung halogensubstituierter Alkane 169 Infotext: "FCKW - die Ozonkiller“ 170 9.2.3 Reaktionsverhalten der Halogenalkane; Induktiver Effekt; Dipolmoleküle 173 9.3 Ungesättigte Kohlenwasserstoffe 175 9.3.1 Ethen und die homologe Reihe der Alkene 175 9.3.2 Die C=C Doppelbindung; σ-π-Modell 177 9.3.3 Reaktionsverhalten von Alkenen; Additionsreaktion 178 9.3.4 Ethin und die homologe Reihe der Alkine 179 9.3.5 Die CC-Dreifachbindung; Bau des Ethinmoleküls 181 9.4 Kohle Erdöl und Erdgas als Energieträger und Rohstoffquelle 182 9.4.1 Die Entstehung der Kohle 182 9.4.2 Die Kohleveredelung 182 9.4.3 Entstehung, Vorkommen und Gewinnung von Erdöl und Erdgas 184 9.4.4 Verarbeitung des Erdöls durch fraktionierte Destillation 185 Infotext: Die Octanzahl – ein Maß für die Klopffestigkeit 186 9.4.5 Die Anwendung des Crackprozesses auf Erdöldestillate 187 Infotext: Regenerative Energiequellen - Energiequellen der Zukunft? 188 10 ALKANOLE UND IHRE REAKTIONSPRODUKTE; FUNKTIONELLE GRUPPEN 191 10.1 Alkanole und Ether 192 Infotext: Die Bundesrepublik Deutschland – ein Land der Alkoholiker? 192 10.1.1 Alkohol durch Gärung 193 Infotext: Der Alkohol und die Promille 194 Infotext: Blutalkoholgehalt und Wirkung auf den Organismus 195 10.1.2 Ermittlung der Summenformel des Ethanolmoleküls 195 10.1.3 Ermittlung der Strukturformel des Ethanmoleküls 197 10.1.4 Homologe Reihe einwertiger Alkohole; Nomenklatur 198 10.1.5 Mehrwertige Alkohole 200 Infotext: Alfred Nobel – ein Mann, der durch Sprengstoff reich wurde 200 10.1.6 Zusammenhang von Struktur und Eigenschaften bei Alkanolen 201 10.1.7 Mechanismus der nucleophilen Substitution zur Herstellung von Alkanolen 203 10.1.8 Ether; Herstellung und Eigenschaften 204 10.2 Alkanale und Alkanone; C=O-Doppelbindung 206 10.2.1 Alkanale als Oxidationsprodukte primärer Alkanole 206 Infotext: Alkohol im Blut – nicht nur ein Fall für die Polizei 208 10.2.2 Reaktionsverhalten der Alkanale 210 Infotext: Silberspiegel lösen die giftigen Quecksilberspiegel ab 212 10.2.3 Alkanone als Oxidationsprodukte sekundärer Alkohole 212 10.3 Carbonsäuren; Substitutionsprodukte und Derivate 214 10.3.1 Monocarbonsäuren (Alkansäuren); Homologe Reihe 214 10.3.2 Physikalisches Verhalten, Acidität und Salze der Monocarbonsäuren 216 10.3.3 Dicarbonsäuren (Alkandisäuren) 219 10.3.4 Halogencarbonsäuren 220 10.3.5 Aliphatische Hydroxycarbonsäuren 221 10.3.6 Amine und Aminocarbonsäuren 222 10.3.7 Optische Aktivität 223 Infotext: Optische Aktivität der Weinsäure 225 10.3.8 Carbonsäureester 226 10.3.9 Carbonsäureamide 228 Infotext: Harnstoff – das Diamid der Kohlensäure 228 11 AROMATISCHE VERBINDUNGEN; REAKTIONSMECHANISMEN 229 Infotext: Benzol – ein giftiger Stoff mit krebserzeugender Wirkung 230 11.1 Aromatische Kohlenwasserstoffe; Halogenderivate 231 11.1.1 Benzol; Eigenschaften, Verwendung, Summenformel 231 11.1.2 Halogenierung von Benzol 231 11.1.3 Zur Entwicklung der Strukturformel des Benzolmoleküls 232 11.1.4 Hydrierungsenergie und Geometrie des Benzolmoleküls 233 11.1.5 Bindungsverhältnisse im Benzolmolekül, Mesomerie und aromatischer Zustand 234 11.1.6 Elektrophile Substitution und radikalische Addition am Benzolmolekül 236 Infotext: DDT und Dioxin – zwei weit verbreitete gefährliche Umweltgifte 238 Infotext: Kondensierte aromatische Kohlenwasserstoffe 238 11.2 Weitere Derivate aromatischer Kohlenwasserstoffe 239 11.2.1 Direkte Einführung von Substituenten in das Benzolmolekül 240 11.2.2 Reduktion der Nitrogruppe: Anilin 242 11.2.3 Nucleophile Substitution am Benzolmolekül; Phenol und Dihydroxybenzole 243 11.2.4 Bromierung von Methylbenzol 245 11.2.5 Benzylalkohol und seine Oxidationsprodukte; aromatische Carbonsäuren 246 11.2.6 Zweitsubstitution am Benzolmolekül; Einfluss von Erstsubstituenten 248 12 NATURSTOFFE 251 12.1 Kohlenhydrate 252 12.1.1 Zucker sind Kohlenhydrate 252 12.1.2 Über den Bau des Glucosemoleküls 253 12.1.3 Die Struktur des Fructosemoleküls 258 Infotext: Wahlverwandtschaft: Glucose – Sorbit – Ascorbinsäure 259 12.1.4 Saccharose (= Rohr- oder Rübenzucker) 259 12.1.5 Zucker in Malz und in der Milch 260 Infotext: Nicht nur Zucker ist süß – über Zuckeraustauschstoffe und Süßstoffe 261 12.1.6 Makromolekulare Kohlenhydrate 263 Infotext: Stärke ist mehr als ein Nahrungsmittel 265 Infotext: Papier: Herstellung und Recycling 267 Infotext: Cellulose – nachwachsender Rohstoff für hochwertige Kunstseide und Membranen 269 12.2 Aminosäuren – Peptide – Proteine 270 12.2.1 Aminosäuren – Aufbau und Eigenschaften 271 Infotext: Cystein – ein Rohstoff mit vielen Anwendungen 274 12.2.2 Aufbau und Analyse von Peptiden 275 Infotext: Insulin – 10 Jahre für die Aufklärung des Molekülaufbaus 277 Infotext: Elektrophorese – eine Trenntechnik der Bioanalytik 278 12.2.3 Die Struktur der Proteine 278 Infotext: Milch – Proteinlieferant für die gesunde Ernährung 282 Infotext: Nucleinsäuren – Informationsträger des Lebens 282 12.3 Fette 284 12.3.1 Aufbau der Fette 285 Infotext: Fettsäuremethylester – Rohstoffe für viele Zwecke 286 12.3.2 Die Fettsäurekomponente in Fetten 287 Infotext: Jedes Fett ist anders 288 12.3.3 Charakterisierung von Fetten 289 Infotext: Die Iodzahl und ihre Ermittlung 290 13 WASCHAKTIVE STOFFE 291 13.1 Am Anfang war die Seife 292 13.1.1 Herstellung von Seife 292 Infotext: Waschaktive Stoffe – gesucht und gefunden 293 13.1.2 Die Eigenschaften einer Seifenlösung 294 13.1.3 Die waschaktive Wirkung der Seife 295 13.1.4 Seife – Waschmittel mit begrenzter Wirkung 296 Infotext: Tenside – grenzflächenaktive Stoffe für gute Kontakte 297 13.2 Wasserhärte und waschaktive Gerüststoffe 298 13.2.1 Die zwei Gesichter der Phosphate 298 13.2.2 Ersatz für Phosphat 299 Infotext: Silicate – umweltverträgliche Enthärter 300 13.3 Synthetische waschaktive Stoffe 301 13.3.1 Anionische Tenside 301 Infotext: Tenside sind unerwünscht als Abfallstoffe 302 13.3.2 Weitere Tensidklassen 303 Infotext: Plantaren® - Sauberkeit mit Hilfe von Fett und Zucker 304 13.4 Waschmittel 305 13.4.1 Waschgut und Waschmittel 306 13.4.2 Zusammensetzung von Waschmitteln 306 13.4.3 Untersuchung von Inhaltsstoffen in Waschmitteln308 Infotext: Ökobilanz –Geschäftsbericht für den Umweltschutz 309 14 FARBSTOFFE 311 14.1 Grundlagen 312 14.2 Synthese einiger Farbstoffe 313 14.3 Zusammenhang zwischen Konstitution und Farbe 315 Infotext: Erklärung der Farbigkeit mit dem MO-Modell 315 14.3.1 Die Polymethinstruktur als Grundmuster aller wichtigen Farbstoffe 316 14.4 Farbmittel und ihre Vielfalt 318 14.5 Technisch wichtige Farbstoffklassen 318 14.5.1 Azofarbstoffe 319 14.5.2 Azofarbstoffe und Gesundheitsrisiken 320 14.6 Verbindung des Farbstoffes mit der Textilfaser 321 Info-Text: Indigo - bewährt seit Jahrtausenden 322 15 ARZNEIMITTEL 323 Info-Text: Aspirin - ein Arzneimittel von Weltruf 324 15.1 Leitsubstanzen 325 15.2 Mechanismen der Arzneimittelwirkung 325 15.2.1 Aspirin® ist ein Enzym-Hemmstoff 325 15.2.2 Sulfonamide und Penicillin stören Biosynthesen in Bakterienzellen 326 Infotext: Die Entdeckung des Penicillins setzt neue Maßstäbe in der Medizin 328 15.2.3 Zell-Rezeptoren und Liganden regeln lebenswichtige Vorgänge 328 15.2.4 Beruhigungsmittel (Tranquilizer) öffnen Ionenkanäle 329 16 KUNSTSTOFFE 331 16.1 Makromolekulare Stoffe - Makromoleküle 332 16.2 Synthese von Kunststoffen 333 16.2.1 Radikalische Polymerisation 333 16.2.2 Ionische Polymerisation 335 16.2.3 Polykondensation 336 Infotext: Nylon und Perlon – wichtige Kondensationsprodukte 337 16.2.4 Polyaddition 338 Infotext: Kunststoffe erleichtern das Leben 338 16.3 Eigenschaften, Struktur und Verwendung 339 16.3.1 Thermoplaste 339 Infotext: Was sind Schrumpffolien? 340 16.3.2 Elastomere 342 Infotext: Zusatzstoffe sind der I-Punkt beim Gummi 344 16.3.3 Duroplaste 344 16.4 Verarbeitung von Kunststoffen 345 16.4.1 Chemiefasern 345 Infotext: Die Baumwolle – eine Naturfaser 346 16.4.2 Schaumstoffe 347 16.5 Variation von Struktur und Eigenschaften 348 16.6 Kunstoffrecycling 350 Infotext: Biologisch abbaubare Kunststoffe 352 Infotext: Kunststoffe haben Zukunft? 352 17 KERNCHEMIE 353 17.1 Atomkerne 354 17.2 Natürliche Radioaktivität 354 17.2.1 Radioaktive Strahlung 355 17.2.2 Chemische Wirkung radioaktiver Strahlen 356 17.2.3 Der radioaktive Zerfall 358 17.3 Die künstliche Kernumwandlung 359 17.3.1 Die Kernreaktion 359 17.4 Die Nutzung der Kernenergie 360 17.4.1 Kernspaltung 360 17.4.2 Gewinnung von Kernenergie durch Kernspaltung 360 17.4.3 Kernreaktoren 361 Infotext: Kernkraftwerke in der Welt 361 Infotext: Uran in der Natur 361 17.4.4 Probleme des Reaktorbetriebes 362 17.4.5 Kernfusion 363 Infotext: Tschernobyl und seine Folgen 364 18 ANALYTISCHE CHEMIE UND IHRE ANWENDUNG IM UMWELTSCHUTZ 365 Infotext: Grundlegende Fragen der Analytischen Chemie 366 18.1 Wichtige analytische Methoden 366 18.1.1 Erkennungsreaktionen 366 18.1.2 Chromatografie 367 18.1.3 Elektrochemische Methoden 370 18.1.4 Spektroskopische Methoden 372 Infotext: 1 Preuße in München gleich 1ppm 376 18.1.5 Qualitative und quantitative Analysen ausgewählter Kationen und Anionen 378 18.1.6 Bestimmung der molaren Masse 383 Infotext: Alle werden mit Vitamin C! Wir prüfen nach 384 Infotext: Den Spuren auf der Spur 384 18.2 Der Umweltschutz – ein Anwendungsgebiet der Analytischen Chemie 386 18.2.1 Das Wasser - Lebensmittel, Lösungsmittel, kostbarstes Gut 386 Infotext: Untersuchung eines Gewässers 392 18.2.2 Luft und Luftverschmutzung - wie kleine Schadstoffmengen große Probleme schaffen 394 Infotext: Unsere Atmosphäre – eine Müllhalde für Autoabgase? 397 18.2.3 Lebensraum Boden - und wie wir damit umgehen 402 19 KOMPLEXVERBINDUNGEN 407 19.1 Liganden verändern Kationen 408 Infotext: Über die Bezeichnung von Komplexverbindungen 410 19.2 Aufbau der Komplexverbindungen 411 19.3 Das H2O-Molekül als Komplexbildner 412 Infotext: Komplexometrische Bestimmung von „Kupfer“ in Wein und Wasser 414 19.4 Stabilität von Komplexen 415 Infotext: Bestimmung der Wasserhärte mit EDTA 417 Infotext: Metallkomplexe mit organischen Verbindungen – Stoffe mit anderen Möglichkeiten 418 20 ANHANG 421 Sicherheit beim Experimentieren 422 Tabellen und Übersichten 432 Namen und Sachverzeichnis 437 Periodensystem der Elemente 446 Weitere Titel aus der Reihe Chemie Sekundarstufe II |
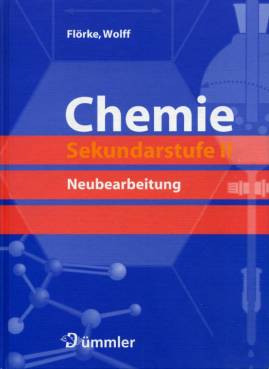
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen