|
|
|
Umschlagtext
Wenn die Droge die Bindungsperson ersetzt
Alkohol, Drogen, Medikamente oder Computerspiele - vieles kann Menschen süchtig machen. Dieses Buch macht Zusammenhänge zwischen Bindung und Sucht deutlich. Internationale renommierte Forscher und Kliniker zeigen therapeutische und präventive Möglichkeiten in Zusammenhang mit Suchterkrankungen auf. Oft beginnt die Sucht mit dem Versuch, großen Stress durch Suchtmittel erträglicher zu machen, anstatt ihn mit Hilfe von Bindungspersonen abzubauen. Auslöser können traumatische Erfahrungen, schwierige psychische Entwicklungsbedingungen oder unlösbare Konfliktsituationen sein. Meistens tritt eine kurzfristige Entspannung ein. Besteht der Stress jedoch weiter, wird er chronisch, dann führt der regelmäßige Griff zum Suchtmittel schnell in eine psychische und körperliche Abhängigkeit. Ist erst einmal das Suchtmittel zur »sicheren Bindungsperson« geworden, wird die Therapie schwierig. Die Beiträge zeigen eindeutig: Es gibt einerseits einen Zusammenhang zwischen Bindung und Sucht, andererseits zwischen Suchtmittel und Bindungsfähigkeit, wobei unterschiedliche Bindungstypen nach unterschiedlichen Substanzen, also z.B. Opiaten, Ecstasy, Alkohol, süchtig sein können. - International renommierte Autoren - Thema »Bindung - Sucht« stark gefragt Das Buch wendet sich an: Kinderärzte, Kinderpsychiater, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, Psychologen, Pädagogen und Berater sowie Therapeuten, die sich mit der Diagnostik und Behandlung von psychosozialen und emotionalen Störungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Suchtproblemen und Abhängigkeitserkrankungen beschäftigen, Hebammen, Geburtshelfer, Stillberaterinnen, Krankenschwestern, Pädagogen, Heilpädagogen, Erzieherinnen, Ergotherapeuten, Krankengymnasten, Sonderpädagogen, Sozialarbeiter, Seelsorger, Juristen, Politiker und Eltern, die mehr über die Zusammenhänge von Bindung und Sucht verstehen möchten. Rezension
Wie hängen "Bindung und Sucht" (Titel!) zusammen? Das Entstehen sicherer Bindungen ist ein wesentliches Element für die gesunde körperliche, psychische und soziale Entwicklung eines Kindes. Die Bindungsforschung hat sich mit dieser Erkenntnis und mit ihrem britischen Pionier John Bowlby (1907-1990) seit der Nachkriegszeit kinderpsychiatrisch etabliert. Bindungstheorie ist ein sozialpsychologisches und psychoanalytisches Konzept, mit dem das enge emotionale Verhältnis erklärt wird, das sich zwischen Kleinkind und Mutter entwickelt. Bindung und Sucht stehen insofern in einem Zusammenhang, als die Droge nicht selten die Bindungsperson ersetzt. Dieses Buch macht Zusammenhänge zwischen Bindung und Sucht in vielfältiger Hinsicht deutlich.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Karl Heinz Brisch, Privatdozent, Dr. med. habil., ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Psychiatrie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie Nervenarzt und Psychoanalytiker. Er leitet als Oberarzt die Abteilung für Pädiatrische Psychosomatik und Psychotherapie im Dr. von Haunerschen Kinderspital, Ludwig-Maximilians-Universität, in München. Er ist Dozent sowie Lehr- und Kontrollanalytiker am Psychoanalytischen Institut Stuttgart. Sein Forschungsschwerpunkt umfasst den Bereich der frühkindlichen Entwicklung zu Fragestellungen der Entstehung von Bindungsprozessen und ihren Störungen. Er ist Vorsitzender der Gesellschaft für Seelische Gesundheit in der Frühen Kindheit (GAIMH e. V., German-Speaking Association for Infant Mental Health). Weitere Informationen zu Karl Heinz Brisch finden Sie unter: www.khbrisch.de Inhaltsverzeichnis
Vorwort 7
Einleitung 9 ANDREAS SCHINDLER Bindung und Sucht – theoretische Modelle, empirische Zusammenhänge und therapeutische Implikationen 13 PHILIP J. FLORES Die Bindungstheorie in ihrer Relevanz für die Suchtbehandlung 32 FABIENNE BECKER-STOLL Bindungsrepräsentation und Therapieerfolg bei essgestörten Patientinnen 60 MICHAEL HASE Traumatisierter sucht Bindung. Über die Zusammenhänge zwischen Bindung, Bindungsstörung, seelischer Traumatisierung und substanzgebundener Abhängigkeit 92 ALEXANDER TROST Drogenabhängige Mütter und ihre Säuglinge – Interaktionsverhalten und Einstellungen 110 KAREN M. FAISANDIER, JOANNE E. TAYLOR, ROBYN M. SALISBURY UND SHANE T. HARVEY Zur Frage des Zusammenhangs zwischen Bindung und unkontrolliertem Sexualverhalten 139 RINA D. EIDEN Zur Bindungssicherheit von Alkoholikerkindern Eine Längsschnittstudie und ihre Relevanz für Intervention und Behandlung 171 KLAUS WÖLFLING Internet- und Computerspielsucht bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 194 JAAK PANKSEPP, VOLKER A. COENEN, MARK SOLMS UND THOMAS E. SCHLÄPFER Warum tut uns die Depression weh? Ererbter primär-bewusster Trennungsschmerz (PANIC) und nachlassende Belohnung (SEEKING) und ihre Bedeutung für das Entstehen von Depression und Abhängigkeit 208 SILKE BIRGITTA GAHLEITNER Gender – Trauma – Sucht und Bindung: Phänomenologie, Wechselwirkungen, Gegenstrategien 234 ARNOLD B. BAKKER, EVANGELIA DEMEROUTI UND RONALD BURKE Arbeitssucht und Beziehungsqualität unter intrapersonellem und interpersonellem Aspekt: Die »spillover-crossover«-Perspektive 253 KARL HEINZ BRISCH Die bindungsbasierte Behandlung von Suchterkrankungen auf verschiedenen Altersstufen 277 Adressen der (Erst-)Autorinnen und Autoren 298 Leseprobe: Vorwort Am 15. und 16. Oktober 2011 wurde an der Poli- und Kinderklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital der Ludwig-Maximilians-Universität München von der Abteilung Pädiatrische Psychosomatik und Psychotherapie eine internationale Konferenz mit dem Titel Bindung und Sucht (Attachment and Addiction) durchgeführt. Das Interesse an dieser Konferenz und die positiven Rückmeldungen waren für die Veranstalter außerordentlich ermutigend, so dass sie die Beiträge dieser Veranstaltung mit der Herausgabe dieses Buches einer größeren Leserschaft zugänglich machen möchten. Die Thematik des vorliegenden Konferenzbandes umfasst eine Vielzahl von Aspekten aus dem Bereich »Bindung und Sucht«: Wie kommt es, dass so verschiedene Substanzen wie Alkohol, Drogen, Medikamente, Nahrungsmittel, aber auch Verhaltensweisen wie Hungern, das Spiel mit Videospielen und Computerkonsolen oder die Nutzung von Geldspielautomaten, Arbeiten und Beziehungen Menschen süchtig machen können? Wie Studien zeigen, beginnt die Sucht oft damit, dass großer Stress, wie er etwa durch schwierige psychische Entwicklungsbedingungen, traumatische Erfahrungen, unlösbare Konfliktsituationen und Ähnliches entstehen kann, nicht mehr gelöst werden kann. Versuchsweise – oft eher zufällig und als »Notlösung« – wird gegen den Stress ein Suchtmittel eingesetzt, statt eine Bindungsperson zu rufen, um mit ihrer Hilfe den Stress unter Kontrolle zu bekommen oder abzubauen. Dies ist erstaunlich, denn normalerweise würde sich ein Mensch, wenn er in Angst und Stress überfordert ist, mit der Bitte um Hilfe an seine Bindungsperson wenden. Wenn diese aber nicht zur Verfügung steht oder vielleicht im Zusammenhang früher Defizite und deprivatorischer Erlebnisse in der Kindheit nie zur Verfügung stand, könnte es sein, dass bereits Kinder sehr früh lernen, als Ersatz für eine Bindungsperson auf suchtartige Verhaltensweisen und Suchtmittel zurückzugreifen. Das Suchtmittel wird auf diese Weise zu einem Bindungsperson- »Surrogat«. Meistens tritt nach dem Gebrauch des Suchtmittels eine kurzfristige, rasche Entspannung ein. Diese fühlt sich so ähnlich an, als wenn die Entspannung durch die emotionale Unterstützung der Bindungsperson erfahren worden wäre. Besteht aber der Stress weiter oder ist er chronisch, wird das Sucht mittel immer öfter benutzt und es entsteht hieraus eine Abhängigkeit, die psychisch und körperlich sein kann. Ist erst einmal das Suchtmittel zur »besten Bindungsperson « geworden, wird die Therapie entsprechend schwierig; denn der Suchtabhängige wird seine »Sucht-Bindungsperson« nicht freiwillig aufgeben. In dem vorliegenden Band werden von internationalen Forschern und Klinikern die Zusammenhänge zwischen Bindungssuche und Suchtverhalten sowie therapeutische und präventive Möglichkeiten vorgestellt und im Zusammenhang ihrer Studien erläutert. Insbesondere auch die therapeutischen und die präventiven Möglichkeiten stehen in einzelnen Beiträgen im Vordergrund. Frühzeitige Interventionen – am besten bereits im Kindesalter – können neue Bindungserfahrungen ermöglichen und so suchtartiges Verhalten verändern und neue beziehungsorientierte Verhaltensweisen auf den Weg bringen. Ich danke allen Autorinnen und Autoren, dass sie ihre Beiträge für die Publikation zur Verfügung gestellt haben. Ein besonderer Dank gilt Frau Ulrike Stopfel, die sehr engagiert – wie in den vergangenen Jahren – alle englischsprachigen Beiträge in hervorragender Qualität übersetzt hat. Dank der exzellenten Arbeit von Herrn Thomas Reichert konnten die einzelnen Manuskripte rasch editiert werden. Ein weiterer Dank gilt Herrn Dr. Heinz Beyer vom Verlag Klett-Cotta sowie Frau Christel Beck dafür, dass sie sich mit unermüdlichem Engagement für die Herausgabe dieses Buches beim Verlag Klett-Cotta eingesetzt bzw. die rasche Herstellung geleistet haben. Ich hoffe, dass dieses Buch allen hilft, die im Rahmen von Therapie, Beratung, sozialer Arbeit sowie bei der Prävention von frühen Störungen tätig sind und die Menschen mit Suchterkrankungen und -erfahrungen – insbesondere Eltern und Kinder sowie Jugendliche – betreuen. Das Buch richtet sich daher auch an Psychotherapeuten, Paar- und Familientherapeuten, Psychiater, Kinder- und Jugendpsychiater, Psychologen und Sozialarbeiter, Pädagogen und Heil pädagogen, Seelsorger, aber auch an Geburtshelfer, Hebammen, Kinderärzte und Krankenschwestern sowie an Richter und Politiker. Möge es allen, die in diesem Kontext mit Suchtgefährdeten oder Suchtkranken arbeiten oder für deren Entwicklung Sorge tragen, zahlreiche Anregungen geben, die sie in ihrer täglichen Arbeit fruchtbar umsetzen können. Karl Heinz Brisch Einleitung Das vorliegende Buch fasst verschiedene Beiträge aus den Bereichen Forschung, Klinik und Prävention zusammen, die sich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema »Bindung und Sucht« beschäftigen. Es werden hierbei sowohl Ergebnisse aus der Grundlagenforschung als auch solche aus empirischen Forschungen dargestellt, die teilweise aus Längsschnittstudien gewonnen wurden. Außerdem werden Erfahrungen aus der klinischen Arbeit anhand von Fallbeispielen anschaulich berichtet, um die therapeutischen Möglichkeiten und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Therapie aufzuzeigen. Andreas Schindler stellt in seinem Beitrag die theoretischen bindungsbasierten Modelle und empirischen Zusammenhänge dar, die seinen therapeutischen Ansätzen für die Arbeit mit Suchtkranken zugrunde liegen, sowie sein therapeutisches Vorgehen. Über viele Jahre hin hat Philip Flores Suchtpatienten in einem bindungsorientierten gruppentherapeutischen Modellprojekt behandelt. Er zeigt, wie die Bindungstheorie fruchtbringend für die Behandlung von suchtkranken, bindungsgestörten, traumatisierten Menschen im Rahmen einer Gruppe genutzt werden kann. Magersüchtige Patientinnen stellen eine große Herausforderung für die Therapie dar. Nicht selten chronifiziert die Essstörung, was mögliche Therapieerfolge stark beeinträchtigt. Fabienne Becker-Stoll hat essgestörte Patientinnen im Hinblick auf ihre Bindungsrepräsentation untersucht und die Bindungsergebnisse im Hinblick auf den Therapieerfolg verglichen. Hierbei wird deutlich, dass die Bindungsrepräsentation einen wichtigen Vorhersagefaktor für den Therapieverlauf und den Therapieerfolg darstellt. Seelische Traumatisierungen sind von großer Bedeutung für den Beginn und den Erhalt von substanzgebundener Abhängigkeit. Michael Hase berichtet, wie die Traumatisierungen das Bindungssystem erschüttern, zu Bindungsstörungen führen und Suchtverhaltensweisen gerade im Sinne von substanzgebundener Abhängigkeit auf den Weg bringen. Er beschreibt, wie er mit diesen Patienten unter einer Bindungs- und Traumaperspektive auch mittels eines speziellen EMDR-Protokolls erfolgreich arbeitet; durch die Methode des EMDR kann er bei den Patienten gezielt auch das Suchtgedächtnis und die damit assoziierten Traumaerfahrungen beeinflussen und ihnen auf diese Weise helfen, Letztere zu verarbeiten. Drogenabhängige Mütter wünschen sich oft, durch eine Schwangerschaft möge alles neu beginnen und auch eigene Verletzungen aus ihrer Kindheit mögen hierdurch wieder »heil« werden. Alexander Trost und sein Team haben mit drogenkranken Müttern und ihren Säuglingen mit Hilfe eines speziellen Interventionsprogramms gearbeitet. Trost zeigt auf, wie sich das Interaktionsverhalten der Mütter und auch ihre Einstellung zu ihrem Säugling auf diese Art und Weise verändern ließen. Sogenannte »Sex Addicts« mit unkontrolliertem Sexualverhalten stellen eine besondere Patientengruppe dar, bei der bisher kaum ein möglicher Zusammenhang zwischen Bindung und Sucht untersucht wurde. Karen Faisandier hat eine entsprechende Studie aufgebaut, die sich genau dieser Fragestellung widmet. Das Protokoll und erste Perspektiven zur Untersuchung werden aus diesem Forschungsprojekt berichtet. Kinder von alkoholkranken Menschen sind in besonderem Maße einer sequentiellen Traumatisierung durch ihre Eltern ausgesetzt, weil diese besonders im alkoholi sierten Zustand nicht feinfühlig mit ihren Kindern umgehen; oftmals kommt es sogar zu Gewalt und Missbrauch gegenüber den Kindern, oder die Kinder sind Zeuge von Gewalt zwischen ihren Bindungspersonen. Auf diese Weise wird ihr Bindungssystem immer wieder neu erschüttert, und es kann kaum zur Entwicklung von sicheren Bindungen kommen; denn die eigentlichen Bindungspersonen stehen nicht für Schutz und Sicherheit, sondern für Bedrohung und Angst, welche die Kinder in deren Gegenwart erleben. Rina Eiden hat über viele Jahre eine Längsschnittstudie aufgebaut, in der sie genau diese Kinder immer wieder im Hinblick auf die Entwicklungsstörungen untersuchte. Aus diesen Erkenntnissen hat sie ein erfolgreiches Interventionskonzept entwickelt. Die Ansätze sowie die Behandlungserfolge werden eindrücklich dargestellt. Für viele Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene stellen heute Internet und Computer- sowie Videospiele eine besondere Suchtquelle dar. Sie verbringen viele Stunden des Tages mit suchtartigem Spielverhalten; dies bedeutet, sie können damit nicht mehr aufhören, vergessen, zu essen und zu trinken, schlafen nicht mehr, vernachlässigen sich und fallen schließlich auch aus sozialen Kontakten heraus und vereinsamen. Da die Zahl dieser Kinder wächst, die von Computerspielen abhängig werden, und sie alle Zeichen einer Suchterkrankung tragen, wurde von Klaus Wölfling in Mainz eine entsprechende Beratungsstelle aufgebaut, die sich genau mit diesem Problem auseinandersetzt und das Verhalten der Süchtigen wie ein sinnvolles therapeutisches Vorgehen erforscht. Das Konzept dieser Beratungsstelle und auch die therapeutischen und beraterischen Erfolge werden in seinem Beitrag im Detail geschildert und weisen auf eine bedeutungsvolle Zielgruppe hin, die unbedingt in Zukunft noch genauer untersucht werden muss, um solchen suchtkranken Kindern entsprechende gezielte Präventionsprogramme in einer größeren Breite zur Verfügung zu stellen. Seit vielen Jahren beschäftigt sich Jaak Panksepp zusammen mit einer Gruppe von Kollegen mit der Frage, warum wir Trennungen in Beziehungen als schmerzvoll erleben und wie sich diese Erfahrungen auf die Entwicklung von Depressionen und auch von Suchtkrankheiten auswirken. In einem eindrucksvollen Beitrag gehen die Forscher genau dieser Frage nach, und die neurobiologischen Zusammenhänge werden gut verständlich erklärt. Beim Erkennen der Zusammenhänge spielt das Bindungssystem eine große Rolle. Silke Gahleitner geht der Frage nach, wie Gender, Trauma und Sucht zusammenhängen und wie diese verschiedenen Bereiche durch das Bindungssystem beeinflusst werden. Gerade in der Jugendhilfe hat sie sich in diesem Kontext intensiv mit den Fragen der Wechselwirkungen und auch der Gegenstrategien beschäftigt. An Fallbeispielen kann sie diese Zusammenhänge anschaulich darstellen. Immer wieder wird in der Presse über Arbeitssucht geschrieben. Arnold Bakker hat sich mit der Gruppe der arbeitssüchtigen Menschen, den sogenannten »Workaholics«, beschäftigt, um mehr Informationen zum Prozess der Entstehung und zur Entwicklung einer suchtartigen Störung aufzeigen zu können. In einem klinisch orientierten Artikel erklärt Karl Heinz Brisch, wie sich die Suchterkrankungen aus bindungstheoretischer Perspektive auf verschiedenen Altersstufen und bei verschiedenen Abhängigkeitsarten verstehen lassen. An Fallbeispielen zeigt er auf, wie auf dem Hintergrund der Bindungsperspektive suchtkranke Menschen auf verschiedenen Altersstufen angesprochen und behandelt werden können und wie die Betroffenen langfristig erfolgreich sichere Bindungen aufbauen können, die dann das Suchtverhalten quasi »ersetzen«. Brisch beschreibt auch eine Variante des primären bindungsorientierten Präventionsprogramms »SAFE® – Sichere Ausbildung für Eltern«, das in einer Modifikation des ursprünglichen Programms ab der Schwangerschaft mit jungen substituierten drogenabhängigen Müttern arbeitet, um ihnen – trotz so schwieriger Startbedingungen – beim Aufbau einer sicheren Bindung zu ihrem Kind zu helfen. Alle Beiträge zusammen vermitteln einen sehr umfassenden Überblick, wie Bindungsentwicklung und Suchtverhalten entstehen und zusammenhängen, besonders dann, wenn die frühen Bindungserfahrungen von Deprivation und Trauma geprägt waren. Die klinisch orientierten Beiträge ermöglichen es, zu erken nen, wie suchtkranke Menschen verschiedener Altersstufen erfolgreich behandelt werden können, wenn ihre Suchterkrankungen aus einer Bindungsperspektive verstanden werden und sich auch der therapeutische Prozess daran orientiert. Die Ergebnisse von Längsschnittstudien und präventiven bindungsorientierten Programmen sind bahnbrechend und weisen darauf hin, dass eine Hilfestellung und Therapie für suchtkranke Kinder und Jugendliche bereits frühzeitig erfor der lich ist. Bei suchtkranken Eltern muss eine Prävention bereits in der Schwangerschaft beginnen, um möglichst zu vermeiden, dass die Kinder später unter den schwierigen Eltern-Kind-Beziehungen leiden. Auf diesem Hintergrund wäre es wünschenswert, dass mehr Ansätze für Therapie und Prävention auf einem bindungstheoretischen Modell aufbauen und für die entsprechenden suchtkranken Patienten weiterentwickelt würden. |
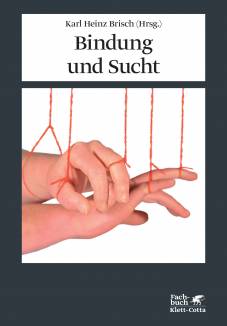
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen