|
|
|
Umschlagtext
Der Autor entwirft, ausgehend von seiner langjährigen Erfahrung als Leiter von historisch-politischen Bildungsseminaren in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau und der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Auschwitz/Oswiecim, ein Konzept für die Bildungsarbeit an den Orten nationalsozialistischen Terrros und in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Dem vorgelagert arbeitet er Perspektiven für die Beschreibung von Opfern, TäterInnen, ZuschauerInnen und der Repression widerstehenden Menschen heraus. Denn in der Bildungsarbeit an diesen historischen Orten geht es immer wieder um die Frage: Lässt sich solch kalte, manchmal auch sadistische Grausamkeit verstehen oder erklären? Gibt es immunisierende Kräfte gegen solches Tun? Können wir Folgen aus dem nationalsozialistischen System für die gegenwärtige Gesellschaft und die politische Bildung in ihr ziehen? Welche politischen, pädagogischen und ethischen Lehren ziehen wir aus einem System, das Europa mit einem Eroberungs- Vernichtungskrieg überzog und andererseits im Binnenraum der NS-Gesellschaft den einen Teil zu privilegierten Herrenmenschen erklärte und den anderen als Volksfeinde ausgrenzte bzw. ermordete? Und es bleibt die Frage: wie notwendig, sinnvoll und hilfreich ist Erinnerung, Gedenken und Bildungsarbeit am historischen Ort?
Rezension
Nicht wenige Schulklassen besuchen Orte nationalsozialistischer Verbrechen wie Auschwitz oder Dachau. Wie aber kann Bildungsarbeit dort sinnvoll und "erfolgreich" sein? Dieses Buch verankert eine "Erziehung nach Auschwitz" in der historisch-politischen Bildungsarbeit im Hinblick auf Gedenkstätten nationalsozialistischer Verbrechen. Welche didaktischen Konzepte können in der Gedenkstätten-Bildungsarbeit hilfreich sein, für wen sind sie geeignet, wie lassen sie sich begründen, wie läßt sich die Genese des sog. Dritten Reiches verstehen, wer waren die Opfer der Nationalsozialisten und wer die Täter? Dieses Buch versucht eine Gesamtdarstellung historisch-politischer Bildungsarbeit in Gedenkstäten des NS-Terrors unter besonderer Berücksichtigung der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau.
Oliver Neumann, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Prof. Dr. Wolf Ritscher, Jahrgang 1948, Dr. phil., M.A., Dipl. Psych., Systemischer Therapeut/Familientherapeut, Psychodramatherapeut und Supervisor, Professor an der Hochschule Esslingen, Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege. Inhaltsverzeichnis
Einführung 11
Teil I TäterInnen, Verfolgte, Ermordete, Überlebende (Opfer), Menschen im Widerstand, ZuschauerInnen Kapitel 1 NS-TäterInnen und NS-Taten – Zur Annäherung an einen Begriff für hochkomplexe Wirklichkeiten 20 1.1 Fragen zur Definition 20 1.2 Vier Zugänge zum Begriff der TäterInnen: die handlungsorientierte, soziologische, psychologische und familiendynamische Perspektive 21 1.2.1 Die Perspektive des (un)sozialen Handelns 23 1.2.2 Die historisch-soziologisch-phänomenologische Perspektive von Raul Hilberg 25 1.2.3 Die psychologische Perspektive 32 1.2.4 Familiendynamisch-transgenerationale Fragen: Drei Generationen in den Familien der TäterInnen 55 Kapitel 2 Die Verfolgten, Ermordeten und Überlebenden 62 2.1 Einleitung und Überblick 62 2.2 Die aus rassistisch-biologistischen Vorurteilen verfolgten Menschen 69 2.2.1 Die europäische Judenheit aus der historisch-soziologisch-phänomenologischen Perspektive von Raul Hilberg 69 2.2.2 Sinti und Roma 84 2.3 Die Unangepassten und dem Normalitätsdiktat entgegenstehenden Menschen 92 2.3.1 Einleitung: Die NS-Idee der Volksgemeinschaft und ihrer „Aufartung“ 92 2.3.2 Wohnungslose, Bettler, Landfahrer, Prostituierte, Menschen mit Alkoholproblemen, Arbeitslose, Multiproblemfamilien und viele mehr 98 2.3.3 Männer mit homosexueller Orientierung 103 2.3.4 Die Unangepassten: Ein Beispiel 106 2.3.5 Die Opfer von Zwangssterilisation und Euthanasie als Zeugen sozialer Unterschiedlichkeit 107 Kapitel 3 Menschen im Widerstand 127 3.1 Widerstand in Deutschland 127 3.1.1 Die „Frauen von der Rosenstraße“ (der „Widerstand des Herzens“) 130 3.1.2 Die „Rote Kapelle“ (der politische Widerstand) 131 3.1.3 Die Zeugen Jehovas: Widerstand aus religiöser Überzeugung 136 3.1.4 Kriegsdienstverweigerer und Deserteure 143 3.2 Widerstand im besetzten Europa 145 3.2.1 Der jüdische Widerstand in Krakau 147 3.2.2 Der organisierte Widerstand im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau und der Aufstand des jüdischen „Sonderkommandos“ 152 3.3 Eine psychologische Skizze zum Widerstand 159 Kapitel 4 ZuschauerInnen 161 4.1 ZuschauerInnen aus der Sicht von Raul Hilberg 162 4.1.1 „Nationen in Adolf Hitlers Europa“ 162 4.1.2 „Helfer, Gewinner und Schaulustige“ 164 4.1.3 „Boten“ 166 4.1.4 „Die jüdischen Retter“ 168 4.1.5 „Die Alliierten“ 169 4.1.6 „Neutrale Länder“ 170 4.1.7 „Die Kirchen“ 171 4.2 Psychologische Perspektiven 173 4.2.1 Die Gleichgültigkeit 173 4.2.2 Die Schaulust 174 4.2.3 Die stellvertretende Erfahrung durch die Identifikation mit dem Aggressor 175 Teil II Gedenkstätten und Bildungsarbeit am historischen Ort: Kontexte, Konzepte, Perspektiven Kapitel 5 Auseinandersetzungen mit dem „Dritten Reich“ in Deutschland nach 1945: Die „Vorgeschichte“ der Gedenkstätten 178 5.1 Die „zweite Schuld“ und die „Unfähigkeit zu trauern“ 178 5.2 Die „Wiedergutmachung“ – Ausdruck der Ambivalenz in der Auseinandersetzung mit dem „Dritte Reich“ und seinen Folgen 180 5.3 Formen einer verantwortungsbereiten Auseinandersetzung mit der deutschen Schuld 188 5.3.1 Meilensteine dieses Prozesses und Menschen, die ihn voranbrachten 188 5.3.2 Erinnerung und Gedenkstätten in der DDR 193 5.3.3 Erinnerung und Gedenkstätten in der BRD 194 5.4 Erinnerungskultur, Historisierung und die politisch-historische Bildung in Gedenkstätten 209 5.4.1 Kommunikatives, kollektives und kulturelles Gedächtnis 209 5.4.2 Kommunikation zwischen den Generationen 213 5.4.3 Zeit, intergenerationale Kommunikation, Historisierung und Multiperspektivität 215 Kapitel 6 „Erziehung nach Auschwitz“ – ein von Theodor W. Adorno geprägter Begriff als Ausgangspunkt der Bildungsarbeit in Gedenkstätten 223 Kapitel 7 Bildungsarbeit in Gedenkstätten im Anschluss an Adornos „Erziehung nach Auschwitz“ 231 7.1 Erinnern, Gedenken und mehrdimensionales Lernen – Leitlinien für die Ermöglichung von Bildungsprozessen in Gedenkstätten 231 7.1.1 Muss erinnert werden? 231 7.1.2 Gedenken, aber wie? 235 7.1.3 Mehrdimensionales Lernen: Lernen mit Kopf, Herz und Hand 238 7.2 Historische, politische und personale Bildung in Gedenkstätten 240 7.2.1 Gedenkstätten 240 7.2.2 Bildungsprozesse in Gedenkstätten 242 7.2.3 BesucherInnen 245 7.2.4 Themen aktueller und zukünftiger Bildungsprozesse in Gedenkstätten 247 Kapitel 8 Bildungsarbeit in Gedenkstätten im Anschluss an Adornos „Erziehung nach Auschwitz“: Methoden und Konzepte für die Praxis 273 8.1 Das Setting der Bildungsarbeit – ein Überblick 273 8.2 Konzepte und Methoden 275 8.2.1 Konzepte und Methoden für die Gruppenarbeit 275 8.2.2 Aktionsmethoden für die Gruppenpädagogik und ihre theoretische Begründung 279 8.2.3 Auf den historischen Ort bezogene Methoden der Bildungsarbeit 280 Teil III Bildungsarbeit am historischen Ort Auschwitz-Birkenau Kapitel 9 Auschwitz als Konzentrations- und Vernichtungslager 296 9.1 Die Entwicklung des Systems der Konzentrationslager 296 9.2 Zur Geschichte das Lagers Auschwitz 301 9.2.1 Eine Skizze der Geschichte des KL Auschwitz 301 9.2.2 Auschwitz: Eine Chronologie 327 Kapitel 10 Bildungsarbeit in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau: Beispiele für das Lernen mit Kopf, Herz und Hand 343 10.1 Das Projekt „Erziehung nach Auschwitz“ an der Hochschule Esslingen 343 10.1.1 Die TeilnehmerInnen 344 10.1.2 Selbstorganisiertes Lernen als Wechselspiel von Freiheit und Eigeninitiative, vorgegebenen Regeln und Information 347 10.1.3 Die Zeit- und Programmstruktur des Projekts 348 10.2 Methoden des eigenständigen Lernens 351 10.2.1 Selbstentdeckendes Lernen: Ein selbstgeleiteter Rundgang zu den für den Häftlingsalltag und die Organisation des Terrors zentralen Orten des Lagers 351 10.2.2 Lernen als Wissenserwerb: Die bürokratische Organisation des Lagers und ihr Spiegel in den Dokumenten des Archivs 410 10.2.3 Lernen durch Erinnern, Gedenken und emotionale Präsenz: Das ZeitzeugInnengespräch 428 10.2.4 Selbstorganisiertes, emotionales und selbstreflexives Lernen: Projektarbeit 432 10.2.5 Lernen mit Kopf, Herz und Hand: Erhaltungsarbeit auf dem alten jüdischen Friedhof von Oświęcim 440 10.2.6 Entdeckendes Lernen: Die Begegnung mit der Stadt Oświęcim 443 Epilog Zweifel und Hoffnung 446 Literatur 448 |
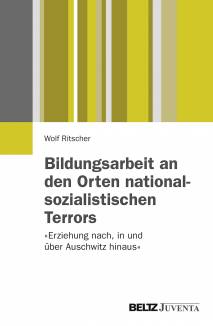
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen