|
|
|
Umschlagtext
Bilder sind auf einzigartige Weise mit dem Sehsinn verknüpft und zeichnen sich dadurch als eine eigenständige Gattung von Kommunikationsmedien aus. Sie "kommunizieren" visuelle Informationen, die vom Bildbetrachter interpretiert werden müssen und setzen deshalb die entsprechenden kognitiven Kompetenzen beim Betrachter voraus. Dieser Befund gilt nicht nur für Bilder, die Kunstwerke sind, sondern auch für Bildmedien in den Wissenschaften sowie für Bilder der populären Massenkultur - angefangen von Fotos aus der politischen Berichterstattung, über Werbeannoncen bis hin zu bewegten Bildern in Form von Musikvideos und Computerspielen. Es gibt entsprechend gute Gründe dafür, Bildwahrnehmung und Bildverarbeitung auf Seiten des Betrachters (endlich) genauso ernst zu nehmen - und sie entsprechend genauso differenziert zu erforschen - wie die Bildproduktion, oder die Bildherkunft und Bildentstehungsgeschichte.
Der vorliegende Sammelband umfasst Beiträge, die einerseits aktuelle empirische Forschungen zu zentralen Fragen der Bildpsychologie, etwa nach dem Verhältnis von Bildwahrnehmung und Gegenstandswahrnehmung, von Emotion und Bildrezeption oder von Bildrezeption und Aufmerksamkeit vorstellen und die sich andererseits reflexiv auf diese empirisch-bildpsychologischen Untersuchungen beziehen, um dadurch die methodologischen Grundlagen einer betrachterorientierten Bildwissenschaft als transdisziplinärem Projekt herauszuarbeiten. Rezension
Bilder prägen unsere Welt. Wir erleben eine tief greifende kulturelle Umwälzung: die Gutenberg-Galaxie scheint an ihr Ende gekommen. 500 Jahre lang haben Bücher und Buchstaben unsere Kultur geprägt, jetzt werden sie zunehmend von Bildern / Icons abgelöst. Deshalb sprechen wir vom sog. Iconic Turn, der neuen Macht der Bilder. Bilder prägen unsere Welt, - nicht nur Bilder, die Kunstwerke sind, sondern auch für Bildmedien in den Wissenschaften sowie für Bilder der populären Massenkultur, von Fotos aus der politischen Berichterstattung, über Werbeannoncen bis hin zu bewegten Bildern in Form von Musikvideos und Computerspielen. mit dem iconic turn sind elementare kulturelle Vorgehensweisen verknüpft, z.B. wird die lineare, sukzessive Wahrnehmung, die Buchstabe an Buchstabe reiht, um sie logisch nacheinander zu entschlüsseln, abgelöst durch eine Simultan-Wahrnehmung, die nicht mehr logisch aufeinander aufbaut, sondern postmodern alles nebeneinander stellen kann. Kinder und Jugendliche sind mit dieser Simultan-Kultur des Iconic Turn schon sehr viel stärker vertraut als viele Erwachsene. Es gibt entsprechend gute Gründe dafür, Bildwahrnehmung und Bildverarbeitung auf Seiten des Betrachters (endlich) genauso ernst zu nehmen - und sie entsprechend genauso differenziert zu erforschen - wie die Bildproduktion, oder die Bildherkunft und Bildentstehungsgeschichte.
Thomas Bernhard, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Autoren und Herausgeber: Christiane Baadte Christiane Baadte, studierte soziale Verhaltenswissenschaften und Erziehungswissenschaften an der Fern Universität Hagen, promovierte 2006 in Philosophie an der TU Kaiserslautern. Seit 2008 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Koblenz-Landau im Fachbereich Psychologie. Ihre Forschungsschwerpunkte sind u.a. Gedächtnis und Wissen, Gedächtnis und Soziale Kognition, Textverstehen, Lernen und Wissenserwerb. Aktuelle Publikationen sind Using diagnostic text information to constrain situation models. Discourse Processes, mit S. Dutke, A. Hähnel, U. von Hecker, M. Rinck sowie Domain learning versus language learning with multimedia. In: Aprendizaje multimodal - Multimodal learning, 2008, mit W. Schnotz. Steffen-Peter Ballstaedt Steffen-Peter Ballstaedt, geb. 1946, studierte Psychologie und Philosophie an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg/Br. und der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen. Seit 2005 ist er Professor für angewandte Kommunikationswissenschaft an der Fachhochschule Gelsenkirchen im Studiengang Journalismus und Public Relations. Er arbeitet als Experte für angewandte Kognitionspsychologie an Problemen der sprachlichen und bildlichen Kommunikation in verschiedenen Medien. Als Industriedozent für didaktisches Design hat er in zahlreichen Firmen Seminare und Workshops zu diesem Thema durchgeführt. Homepage: http://www.fh-gelsenkirchen.de/fb02/homepages/ballstaedt/index.html Katharina Diergarten Katharina Diergarten, geb. 1983, studierte Psychologie an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg und promovierte 2010. Von 2007 bis 2008 war sie Stipendiatin der Bayerischen Eliteförderung und ist seitdem assoziiertes Mitglied im Graduiertenkolleg Processing of affective stimuli: from the molecular basis to the emotional experience, seit 2008 ist sie in Lehre und Forschung am Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie der Universität Würzburg tätig. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Entwicklungspsychologie, Emotionspsychologie, Medienpsychologie; Schwerpunkte in der Forschung liegen in der Emotionalen Inferenzbildung, Medialen Zeichenkompetenz bei Kindern, Entwicklungen des Emotionswissens. Ferdinand Fellmann Ferdinand Fellmann, geb. 1939; studierte Philosophie, Anglistik und Romanistik an der Universität Münster, Gießen und Bochum, promovierte 1967 und habilitierte sich 1973. Er ist Professor für Philosophie und Wissenschaftstheorie an der TU Chemnitz. Seine Forschungsschwerpunkte sind Geschichtsphilosophie, Hermeneutik, Lebensphilosophie und Philosophische Anthropologie. Wichtige thematische Veröffentlichungen sind Innere Bilder im Licht des imagic turn. In: K. SACHS-HOMBACH (Hrsg.): Bilder im Geiste. Zur kognitiven und erkenntnistheoretischen Funktion piktorialer Repräsentationen, 1995; Bedeutung als Formproblem – Aspekte einer realistischen Bildsemantik. In: K. SACHS-HOMBACH; K. REHKÄMPER (Hrsg.): Vom Realismus der Bilder, 2000; Das Paar. Eine erotische Rechtfertigung des Menschen, 2005; Das Paar als Quelle des Selbst. Zur den soziobiologischen Grundlagen der philosophischen Anthropologie. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 2009. Charles Forceville Charles Forceville, born 1959, studied English (Vrije Universiteit Amsterdam) and lectured in the departments of English, comparative literature, and Word & Image. From 1996-1998 he did a post-doc on Narration in fiction and film (Universiteit Leiden). Since 1999 he has worked, in the Media Studies department of the University of Amsterdam, where he directs the department’s Research Master program. He published Pictorial Metaphor in Advertising, 1996; and the co-edited volume Multimodal Metaphor, Mouton de Gruyter in press. He is a member of the advisory boards of Journal of Pragmatics, Metaphor and Symbol, Atlantis, and Public Journal of Semiotics. Forceville’s teaching and research are inspired by cognitivist-oriented models in linguistics and film, and focus on the structure and rhetoric of multimodal discourse in advertising, documentary, animation, comics, and cartoons. Rainer Höger, geb. 1954, studierte Psychologie an der TU Berlin, promovierte 1986 im Bereich der Pschoakustik und habilitierte sich 1994 auf dem Gebiet der visuellen Wahrnehmungsforschung. Seit 2003 ist er Professor der Arbeits- und ingenieurpsychologie zunächst an der Fachhochschule Nordostniedersachsen, dann an der Universität Lüneburg. Seine Forschungsschwerpunkte sind Aufmerksamkeitsforschung, kognitive Psychologie und künstliche Intelligenz, Unfallforschung. Veröffentlichungen sind u.a. Chaosforschung und ihre Perspektiven für die Psychologie, 1992; Speed of processing and stimulus complexity in low and high frequency channels, 1997; Raum-zeitliche Prozesse der visuellen Informationsverarbeitung, 2001; Mental models and attentional processes in car driving, 2005. Holsanova, Jana Jana Holsanova, born 1962, is Associate Professor in Cognitive Science at Lund University, Sweden. She works as senior researcher at the Linnaeus Centre for Cognition, Communication and Learning, focusing on cognitive processes underlying language use, picture viewing and mental imagery. In her work, she uses eye-tracking methodology along with simultaneous or retrospective verbal protocols. Her recent book Discourse, Vision, and Cognition, 2008, explores the relationship between language, eye movements and cognition, and brings together discourse analysis with cognitively oriented behavioral research. A list of projects and selected publications is available here. Huber, Hans-Dieter Hans Dieter Huber, geb. 1953, ist Künstler, Filmemacher und Wissenschaftler. Er studierte Malerei und Grafik an der Akademie der bildenden Künste München sowie Kunstgeschichte, Philosophie und Psychologie in Heidelberg. 1997 bis 1999 war er Professor für Kunstgeschichte an der HGB Leipzig; seit 1999 ist er Professor für Kunstgeschichte der Gegenwart, Ästhetik und Kunsttheorie an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Seit Mai 2006 leitet er dort den Internationalen Master-Studiengang Konservierung Neuer Medien und digitaler Information. Von März bis Juni 2007 war er Senior Fellow am Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien. Von Dezember 2006 bis November 2009 war er als Professor am Graduiertenkolleg Bild, Körper, Medium an der HfG Karlsruhe assoziiert. Sermin Ildirar Sermin Ildirar, received her PhD from the University of Istanbul in 2008. Since 2003 she has been a Research Assistant at Istanbul University, Communication Faculty. She has taught Film Directing, Script Writing, Global Understanding at Istanbul University. Her work focuses on cognitive film theory, experimental film studies, narratology, media psychology and intercultural dialogue. She published Watching Film for the First Time: How Adult Viewers Interpret Perceptual Discontinuities in Film, in press, with S. Schwann; Humorous anthropomorphisation in an educational video for patients with autoimmune diseases. In: Journal of Czech and Alovak Psychiatry, 2008, with B. Ilievski, G. Erman, K. Tascilar, K. Spiess. Oliver Jehle Oliver Jehle, geb. 1974, studierte Kunstgeschichte, Germanistik, Philosophie und Mittelalterliche Geschichte und promovierte 2005 an der Freien Universität Berlin. Seit dem Wintersemester 2007/2008 ist er Assistent am Lehrstuhl für Kunstgeschichte der Universität Regensburg. Seine Forschungsschwerpunkte sind Werkprozesse (Skizze, Entwurf, Zeichnung), Kunsttheorie und Ästhetik um 1800 sowie Text-Bild-Hybride (Emblematik), Rhetorik und Wissenschaftssprache um 1600. Letzte themenverwandte Veröffentlichungen sind Spinnen, Spuren, Sensationen. Zur neuronalen Ästhetik der Empfindsamkeit. In: A. HENNIG U.A. (Hg.): Bewegte Erfahrungen – Zwischen Emotionalität und Ästhetik, 2008; Zerkratzte Bilder – Gainsboroughs Faktur und die Macht der Diskurse. In: M. ROTHE; H. SCHRÖDER (Hg.): Stil, Stilbruch, tabu: Stilerfahrung nach der Rhetorik. Eine Bilanz, 2008; ›Dochtschere und Augenglas‹ Joseph Wright, John Locke und das denkende Auge. In: U. NORTMANN.; C. WAGNER (Hrsg.): In Bildern denken? Kognitive Potentiale von Visualisierung in Kunst und Wissenschaft, im Erscheinen. Kalkofen, Hermann Hermann Kalkofen, geb. 1940, studierte Psychologie, promovierte 1969 an der Universität Braunschweig und wurde 1993 zum Honorarprofessor an der Universität Göttingen bestellt. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Psychologische Optik, visuelle Kommunikation und experimentelle Ästhetik. Körber, Bernd Bernd Körber, geb. 1967, studierte Psychologie, promovierte 2003 an der Universität Düsseldorf und ist seit 2003 an der Universität Regensburg tätig. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Wahrnehmungspsychologie, Polizeipsychologie und Bildwissenschaft. Kondor, Zsuzsanna Zsuzsanna Kondor, born 1966, is Senior Research Fellow at the Institute for Philosophical Research of the Hungarian Academy of Sciences. Research interests are history of philosophy, philosophy of communication, the cognitive difference of pictorial and verbal representations and its impact on thinking, the role of embodiment in cognition and reasoning. Some recent publications are »Beyond Mental Representation: Dualism Revisited. In: V. A. MUNZ; K. PUHL; J. WANG (ed.): Language and the World. Papers of the 32th International Wittgenstein, Symposium, 2009; Embedded Thinking: Multimedia and the New Rationality, 2008; The Mobile Image: Experience on the Move. In: K. NYÍRI (ed.): Mobile Studies: Paradigms and Perspectives, 2007; Multimodal Integration: From a Philosophical Point of View. In: I. ARNEDILLO-SANCHEZ (ed.): Proceedings of the IADIS International Conference: Mobile Learning, 2007. Kulvicki, John John Kulvicki, received his PhD from the University of Chicago in 2001. He has taught at Washington University in St. Louis, Carleton University in Ottawa, and Dartmouth College, New Hampshire, where he is currently Assistant Professor of Philosophy. His work focuses on philosophy of images, philosophy of art, and philosophy of perception. Leder, Helmut Helmut Leder, geb. 1963, studierte Psychologie in Düsseldorf, Bonn und Aachen, promovierte in Fribourg, habilitierte an der Freien Universität Berlin, seine Forschungsaufenthalte waren in Stirling, Takanohara, an der UCS und UCSD und am Languages of Emotion-Cluster an der FU Berlin. Aktuell ist er Professor für Allgemeine Psychologie und Institutsvorstand des Instituts für Psychologische Grundlagenforschung an der Universität Wien, Sprecher des fakultären Forschungsschwerpunktes Psychologische Ästhetik und Kognitive Ergonomie. Zahlreiche Veröffentlichungen liegen in der empirischen Ästhetik, Designwahrnehmung und Gesichtswahrnehmung. Andreas Müller Andreas Müller, geb. 1959, studierte Physik in Heidelberg, Grenoble und Göttingen, promovierte 1990 und habilitierte sich 1996 im Fachbereich Physik in Gießen. Er arbeitet u.a. am MPI für Kernphysik, Heidelberg, am Institut für Didaktik der Physik, an der Universität Gießen und am Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften, Kiel sowie als Professor für Physik bzw. Didaktik der Physik an der Fachhochschule Wiesbaden, Universität Dresden, Universität Bochum und seit 1999 an der Universität Koblenz-Landau. Seine Forschungsinteressen und Projekte liegen u.a. in den Bereichen Alltagsphysik, fächerübergreifender Unterricht, Freihandexperimente; Empirische Untersuchung und Weiterentwicklung fachdidaktischer Ansätze auf psychologischer Grundlage, insbesondere der Rolle von Aufgaben beim Lernen und Unterrichten von Physik und der Lehrerbildung. Aktuelle Publikationen sind u.a. Kontextorientierung im Physikunterricht. Konzeptionen, Theorien und Forschungsergebnisse zu Motivation und Lernen. In: Praxis der Naturwissenschaften: Physik, 2010 mit J. Kuhn, W. Müller, P. Vogt; Der Körper als Wärmemaschine. In: Physik in unserer Zeit 40 (2/09); Pseudobeugung. In: Physik in unserer Zeit 40 (1/09). Nieding, Gerhild Gerhild Nieding, geb. 1964, studierte Psychologie an der TU Berlin, promovierte 1995 und habilitierte sich 2002. Als Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Assistentin in Berlin tätig, erhielt sie 2002 eine Hochschuldozendur an der Universität Münster für Entwicklungspsychologie, seit September 2002 ist sie Universitätsprofessorin für Entwicklungspsychologie an der Universität Würzburg. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Entwicklungspsychologie, Medienpsychologie, Kognitive Psychologie; Schwerpunkte in der Forschung liegen bei den Laborexperimentellen Methoden zur Messung von Medieneffekten bei Kindern und Erwachsenen, Kognitive Filmpsychologie, Lernen mit Medien, die Entwicklung des Textverstehens und des Gedächtnisses, Förderung von Raumkognitionen durch Filme und Entwicklung von mathematischen Kompetenzen. Aktuell untersucht sie Entwicklungen des Verstehens medialer Symbolsysteme (Entwicklung und Medien). Nyiri, Kristóf Kristóf Nyiri, geb. 1944, ist Professor für Philosophie am Institut für Angewandte Pädagogik und Psychologie der Technischen und Wirtschaftswissenschaftlichen Universität Budapest, Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und der Weltakademie für Philosophie. Seit 2001 leitet er das gemeinsame interdisziplinäre gesellschaftswissenschaftliche Forschungsprojekt Kommunikation im 21. Jahrhundert von T-Mobile Hungary und der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (http://www.socialscience.t-mobile.hu). Seine Forschungsschwerpunkte sind Wittgenstein, Philosophie der Kommunikation, Philosophie des Bildes, Philosophie der Zeit. Einige wichtigere Veröffentlichungen sind Tradition and Individuality: Essays, 1992; Vernetztes Wissen: Philosophie im Zeitalter des Internets, 2004; Verbildlichung und die Grenzen des wissenschaftlichen Realismus. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 2008; Film, Metaphor, and the Reality of Time. In: New Review of Film and Television Studies, 2009. Rasch, Renate Renate Rasch, studierte Lehramt Primarstufe in Eisenach und Mathematik am Institut für Grundschulmethodik der Pädagogischen Hochschule Erfurt, promovierte 1982 und habilitierte sich 2001. Seit 2001 hat sie die Professur für Didaktik des Mathematikunterrichts an Grund- und Hauptschulen an der Universität Koblenz-Landau, Campus Landau inne. Forschungsinteressen liegen in Textaufgaben im Mathematikunterricht der Grundschule und Individuelle Unterschiede beim Mathematiklernen. Publikationen sind u.a. Offene Aufgaben für individuelles Lernen im Mathematikunterricht der Grundschule 3/4. Aufgabenbeispiele und Schülerbearbeitungen, 2007, Textaufgaben in der Grundschule. Lernvoraussetzungen und Konsequenzen für den Unterricht. In: mathematica didactica 32, 2009, Offene Zugänge zu Sachaufgaben. In: Grundschulunterricht 2010. Sachs-Hombach, Klaus Klaus Sachs-Hombach, geb. 1957, studierte Philosophie, Psychologie und Germanistik in Münster, promovierte 1990 und habilitierte sich 2003. Er nahm Forschungsaufenthalte in Oxford und am MIT in Cambridge (MA) wahr. Seit 2007 hat er die Professur für Philosophie mit dem Schwerpunkt Kognitionswissenschaften an der TU Chemnitz inne. Seine Forschungsschwerpunkte sind Bild-, Zeichen-, Medien- und Kommunikationstheorien, Ästhetik und Kulturtheorie, philosophische Probleme der Psychologie, Psychologiegeschichte und Kognitionswissenschaft. Er ist Mitgründer und -leiter der Internetplattform Virtuelles Instituts für Bildwissenschaft (VIB), der Online-Zeitschrift IMAGE, Journal for interdisciplinary image science und der Gesellschaft für interdisziplinäre Bildwissenschaft (GIB). Wichtige Veröffentlichungen sind u.a. Philosophische Psychologie im 19. Jahrhundert, 1993; Das Bild als kommunikatives Medium. Elemente einer allgemeinen Bildwissenschaft, 2003; (als Hg.): Was ist Bildkompetenz? 2003; Wege zur Bildwissenschaft. Interviews, 2004; (als Hg.): Bildwissenschaft zwischen Reflexion und Anwendung, 2005; (als Hg.): Bild und Medium. Kunstgeschichtliche und philosophische Grundlagen der interdisziplinären Bildwissenschaft, 2006; (als Hg.): Bildwissenschaft. Disziplinen, Themen und Methoden, 2005. (als Hg.): Bildtheorien. Anthropologische und kulturelle Grundlagen des visualistic turn, 2008. Schirra, Jörg Jörg R.J. Schirra, geb. 1960, studierte Informatik, Physik, Philosophie, Linguistik und Psychologie an der Universität des Saarlandes. Nach einem längeren Forschungsaufenthalt in Berkeley, Kalifornien, war er verantwortlich für den Aufbau des Studiengangs Computervisualistik an der Fakultät für Informatik der Universität Magdeburg, wo er sich auch habilitierte. Gegenwärtig arbeitet er mit einer Gruppe von Bildwissenschaftlern an einem online-Glossar der Bildphilosophie. Seine Forschungsschwerpunkte sind Grundlagen der Computervisualistik und Medieninformatik, philosophische Bildtheorie und Medienanthropologie. Schmauks, Dagmar Dagmar Schmauks, geb. 1950, apl. Professorin für Semiotik an der Technischen Universität Berlin. Wichtigste Veröffentlichungen sind Deixis in der Mensch-Maschine-Interaktion, 1991; Multimediale Informationspräsentation am Beispiel von Wetterberichten, 1996; Die Stellung des Schweigens im semiotischen Feld, 1996; Landkarten als synoptisches Medium, 1998, mit W. Nöth; Geschlechtswechsel, 1999, mit F. Pfäfflin; Orientierung im Raum. Zeichen für die Fortbewegung, 2002; Der tote Mensch als Zeichen, 2005; Semiotische Streifzüge. Essays aus der Welt der Zeichen, 2007; Denkdiäten, Flachflieger und geistige Stromsparlampen. Die kognitive Struktur von Redewendungen zur Dummheit, 2009; rund 100 Aufsätze schrieb sie überwiegend zur Angewandten Semiotik, insbesondere zu den Themen: Bildpragmatik, Orientierung im Raum durch Zeichen, Täuschen in verschiedenen Medien, Kommunikationsverzicht, taktile Wahrnehmung und Kommunikation sowie semiotische Aspekte der Mensch-Tier-Beziehung und des Umgangs mit Verstorbenen. Schnotz, Wolfgang Wolfgang Schnotz, geb. 1946, studierte Psychologie und Erziehungswissenschaften an der Universität zu Wien, der Universität Mannheim und der Freien Universität Berlin, promovierte 1978 an der Technischen Universität Berlin und habilitierte sich 1991 in Tübingen. Seit 1995 ist er Professor für Allgemeine und Pädagogische Psychologie an der Universität Koblenz-Landau, seit 1999 Leiter der Arbeitsstelle Multimedia und seit 2006 Leiter der Graduiertenschule Unterrichtsprozesse der Universität Koblenz-Landau. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Lernen mit multiplen Repräsentationen, Text-Bild-Integration, Lernen mit Animationen, Rolle des Arbeitsgedächtnisses beim Wissenserwerb. Schürmann, Eva Eva Schürmann Dr. phil., geb. 1967, studierte Philosophie, Kunstgeschichte und Literaturwissenschaft an der Ruhruniversität Bochum. Zwischenzeitliche Studienaufenthalte in Paris, Cambridge, Bologna, Magister 1994 über Spinozas Ethik. Sie promovierte 1998 über James Turrell und Merleau-Ponty, habilitierte sich 2007 zum Thema Sehen als Praxis. Seit September 2009 ist sie Professorin für Kulturphilosophie und Ästhetik an der HAW Hamburg. Neuere Veröffentlichungen sind Das unendliche Kunstwerk, 2005, mit G. Gamm (Hg.); Philosophie im Spiegel der Literatur, 2007, mit G. Gamm und A. Nordmann (Hg.); Sehen als Praxis. Ethisch-ästhetische Studien zum Verhältnis von Sicht und Einsicht, 2008. Schwan, Stephan Stephan Schwan, geb. 1960, studierte Psychologie, promovierte 1992 und habilitierte sich 2000 in Tübingen. Er unterhielt Tätigkeiten am Psychologischen Institut der Universität Tübingen und am Deutschen Institut für Fernstudienforschung (DIFF), 2002 bis 2004 war er Professor für E-Learning und Leiter der Abteilung für Sozial- und Organisationspsychologie an der Johannes Kepler Universität Linz. Seit 2004 ist er Professor für Lehr-Lern-Forschung und Leiter der Arbeitsgruppe Wissenserwerb mit Cybermedien am Institut für Wissensmedien (IWM) in Tübingen. Aktuelle Forschungsschwerpunkte sind Kognitive Verarbeitung dynamischer Bildmedien, informelles Lernen im Museum und das Lernen in virtuellen Realitäten. Stoellger, Philipp Philipp Stoellger, geb. 1967, studierte evangelische Theologie und Philosophie in Göttingen, Tübingen und Frankfurt/M., promovierte 1999 und habilitierte sich 2006. Er ist Mitbegründer und Mitglied des Züricher Kompetenzzentrums, des Interdisziplinären Psychoanalytischen Forums (IPF) von der Universität und ETH Zürich und Mitherausgeber der Reihe Interpretation Interdisziplinär’ bei Königshausen und Neumann. Seit 2007 hat er die Professur für Systematische Theologie und Religionsphilosophie an der Theologischen Fakultät der Universität Rostock inne. Seine Forschungsschwerpunkte sind u.a. die Hermeneutik und die Erforschung der Präsenz der Psychoanalyse und ihr Entwicklungspotential im akademischen Kontext. Aktuelle Veröffentlichungen sind Präsenz und Entzug. Ambivalenzen ikonischer Performanz, vorauss. 2010; Die Passion des Phänomenologen. Zur Arbeit an Hans Blumenbergs Religionsschrift, vorauss. 2010; Theologische Studien; ›In God we trust.‹ Trust in the making – and in becoming. In: C. WELZ (Hg.): Trust, emotions and uncertainty, vorauss. 2010. Strack, Micha Micha Strack, geb. 1965, studierte Psychologie, promovierte 1998 und habilitierte sich 2003 in Psychologie und ist als Privatdozentin an der Universität Göttingen tätig. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Sozialpsychologie, Wirtschaftspsychologie und psychologische Statistik. Suetterlin, Christine Christine Suetterlin, geb. in Zürich, studierte Kunstgeschichte, deutsche und französische Literatur und Philosophie in Zürich und promovierte 1977. Sie war Mitglied der Studiengruppe Biologische Grundlagen der Ästhetik der Reimers Stiftung (1980-1983), seit 1983 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Forschungsstelle für Humanethologie der Max Planck Gesellschaft in Seewiesen und Andechs, ab 1996 des Humanethologischen Filmarchivs der Max Planck Gesellschaft (I. Eibl-Eibesfeldt) in Andechs. Projekt Ethologie der Kunst und ästhetischen Wahrnehmung, Stadtethologie (Verhalten auf Plätzen). Ihre Forschungsschwerpunkte sind kommunikative und bildwissenschaftliche Aspekte der Kunst aus evolutionsbiologischer Sicht, Symbol- und Universalienforschung im Kulturenvergleich, Schnittstellen ethologischer und kulturspezifischer Codierung künstlerischer Kommunikation. Totzke, Rainer Rainer Totzke, studierte Journalistik und Kulturwissenschaften an der Universität Leipzig und promovierte 2002 an der Universität Leipzig im Bereich Philosophie. Nach Lehraufträgen an den Instituten für Philosophie und für Kulturwissenschaft der Universität Leipzig war er von 2007 bis 2008 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Philosophie der Technischen Universität Chemnitz. Seit 2008 arbeitet er als PostDoc-Stipendat am DFG-Graduiertenkolleg Schriftbildlichkeit der Freien Universität Berlin. Wissenschaftliche Arbeitsgebiete sind Medienphilosophie, Kulturphilosophie und Philosophie-Vermittlung. Publikation Buchstaben-Folgen. Schriftlichkeit, Wissenschaft und Heideggers Kritik an der Wissenschaftsideologie, 2004. Inhaltsverzeichnis
Klaus Sachs-Hombach / Rainer Totzke 9
Einleitung 1. Methodologisch-Philosophische Grundlagen der Bildwissenschaft Kristóf Nyíri 13 Gombrich on Image and Time Charles Forceville 33 Practical cues for helping develop image and multimodal discourse scholarship Ferdinand Fellmann 52 Vom Selbstbild zum Selbstbewusstsein. Evolutionsbiologische Grundlagen der Bildwissenschaften John Kulvicki 66 Twofoldness and Visual Awareness Eva Schürmann 93 Transitions from Seeing to Thinking. On the Relation of Perception, Worldview and World-disclosure Zsuzsanna Kondor 106 The Verbal and the Sensual Mind. On the Continuity of Cognitive Processes Philipp Stoellger 123 Die Aufmerksamkeit des Bildes. Intentionalität und Nichtintentionalität der Bildwahrnehmung – als Aspekte der Arbeit an einer ›Bildakttheorie‹ Jörg R. J. Schirra / Klaus Sachs-Hombach 144 Homo pictor and the Linguistic Turn. Revisiting Hans Jonas’ Picture Anthropology 2. Empirisch-Psychologische Forschungen Helmut Leder 181 Bilder als Kunst. Psychologische Ansätze Sermin Ildirar / Stephan Schwan 192 Watching films for the first time Wolfgang Schnotz / Christiane Baadte / Andreas Müller / Renate Rasch 204 Kreatives Denken und Problemlösen mit bildlichen und beschreibenden Repräsentationen Rainer Höger 253 Aufmerksamkeit und Blickbewegungen. Wie wir Bilder durchmustern Hermann Kalkofen / Bernd Körber / Micha Strack 265 Was wurde aus Wickhoffs ›kontinuierender Darstellungsweise‹? Ein Fall von person repetition blindness Jana Holsanova 291 How we focus attention in picture viewing, picture description and mental imagery Anna Katharina Diergarten / Gerhild Nieding 314 Do children infer movie characters’ emotional states? Results of an empirical study 3. Einzelaspekte und Anwendungen Hans Dieter Huber 333 Bildinterpretation. Der Übergang zwischen Wahrnehmung und Sprache Christa Sütterlin 349 Gestus und Pathos. Zur Ritualisierung von Ausdrucksgebärden in der Kunst und einiges zu Warburgs ›Pathos-Formel‹ Oliver Jehle 383 ›Der Heilige Paraleipomenon‹. Laurence Sterne und die Embleme der Abstraktion Dagmar Schmauks 402 Denken und sein Misslingen in Redewendungen und Cartoons Steffen-Peter Ballstaedt 428 Interkulturelle technische Kommunikation mit Bildern Autorinnen und Autoren 442 Leseprobe: Klaus Sachs-Hombach / Rainer Totzke Einleitung Bilder sind auf einzigartige Weise mit dem Sehsinn verknüpft und zeichnen sich dadurch als eine eigenständige Gattung von Kommunikationsmedien aus. Sie ›kommunizieren‹ visuelle Informationen, die vom Bildbetrachter interpretiert werden müssen, und setzen deshalb kognitive Kompetenzen beim Betrachter voraus. Dieser Befund gilt nicht nur für Bilder, die Kunstwerke sind, sondern auch für Bildmedien in den Wissenschaften sowie für Bilder der populären Massenkultur – angefangen von Bildern aus der politischen Berichterstattung über Werbeannoncen bis hin zu bewegten Bildern in Form von Musikvideos und Computerspielen. Es gibt entsprechend gute Gründe dafür, Bildwahrnehmung und Bildverarbeitung aufseiten des Betrachters genauso ernst zu nehmen – und sie entsprechend genauso differenziert zu erforschen – wie die Bildproduktion, Bildherkunft und -entstehungsgeschichte. Denn die Geschichte der Bilder ist immer auch eine Geschichte der Bildbetrachtung und der kommunikativen Wirkungen von Bildern. Oder spezifischer ausgedrückt: Ein angemessenes Verständnis des Phänomens Bildkommunikation erfordert nicht nur, ikonografische Vorbilder eines konkreten Bildes zu kennen, Stilmittel und Materialität zu analysieren und den historischen und sozialen Entstehungskontext zu rekonstruieren, sondern auch, die Bilder in ihren psychologischen, sozialen und kulturellen Wirkungen auf die Bildbetrachter beurteilen zu können. Genau dieser rezeptiven Seite der Bildkommunikation widmet sich der hier vorliegende Sammelband. Der Schwerpunkt des Buches liegt dabei auf einer Disziplin, die vielleicht wie keine andere dafür prädestiniert ist, Impulse für eine betrachterorientierte Perspektive innerhalb der bild10 Klaus Sachs-Hombach / Rainer Totzke wissenschaftlichen Debatte zu geben: der empirischen Psychologie. Dieser geht es weniger um die Interpretation von Bildern, sondern um die experimentelle Analyse von Bildwirkungen und damit insbesondere der perzeptuell-kognitiven Voraussetzungen, die ein Bildbetrachter hat bzw. im Umgang mit Bildern haben muss. Tatsächlich gibt es in den letzten Jahren eine wachsende Zahl von psychologischen Untersuchungen zum Sehen von Bildern und zum Verhältnis von visueller und Bildwahrnehmung. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Fähigkeit zur Bildbetrachtung einerseits universelle kognitive Grundfunktionen (z. B. Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Gestaltwahrnehmung) voraussetzt, sie andererseits aber auch als kognitive und interpretatorische Fähigkeit (visual literacy) im Laufe der Sozialisation in einem spezifischen Kulturkreis erlernt wird. Die Kenntnisnahme der Ergebnisse und methodischen Herangehensweisen empirischer bildpsychologischer Untersuchungen dürfte für das Projekt einer allgemeinen Bildwissenschaft eine fundamentale methodologische Bedeutung besitzen. Denn nach wie vor ist es innerhalb dieser sich erst etablierenden Wissenschaft unklar, in welchem Maße man überhaupt in der Lage ist, Bildbetrachtung nach wissenschaftlichen Standards zu erfassen – und welche Standards dabei maßgeblich sein sollen. Bei der Klärung dieser Frage kommt der Psychologie insofern eine zentrale Bedeutung zu, als sie bei der Erforschung der Wahrnehmung, kognitiven Verarbeitung und Interpretation von Bildern durch die Bildbetrachter immer auch methodologische Fragen diskutiert und diskutieren muss, etwa die, wie kommunikative Wirkungen von Bildern überhaupt zu erfassen sind. Hier ist dann auch die Schnittstelle zur Philosophie zu suchen, deren Geschäft es ist und sein soll, im Gespräch mit den Einzeldisziplinen Hilfestellung bei der Klärung von begrifflichen und methodologischen Fragen anzubieten, transdisziplinär Übersichten zu schaffen und Perspektivwechsel anzuregen. Die Fokussierung auf den Bildbetrachter ist ein solcher Perspektivwechsel in der Bildforschung, der im Folgenden in seiner Bedeutung für die Bildforschung noch einmal genauer akzentuiert werden soll: Die Bildforschung – so schlagen wir vor – lässt sich differenzieren in eine Bilderwissenschaft und eine Bildwissenschaft (vgl. blum/sachs-hombach/ schirra 2007: 121). Die Bilderwissenschaft ist dann ein Unternehmen, das sich – analog zur Literaturwissenschaft im Sprachbereich – mit einzelnen Bildern oder auch spezifischen Bildklassen befasst. Ihr geht es 11 Einleitung wesentlich um ein Verständnis einzelner Bilder, Bildklassen oder auch spezifischer Bildfunktionen, etwa um die besonderen Verfahren und Leistungen ästhetisch hochwertiger Bilder. Horst Bredekamp etwa vertritt eine Auffassung vom Gegenstand und von der methodischen Ausrichtung der Bildforschung, die man entsprechend eher dem Bereich der Bilderwissenschaft zuordnen könnte, insofern es ihm vor allem um »die Methoden der materialen Bestimmung, der historischen Zuschreibung und der semantischen Deutung« (bredekamp 2003: 56) geht. Bredekamp würde diese Charakterisierung freilich verstehen als eine Bestimmung der Bildwissenschaft, wohingegen wir vorschlagen möchten, dass das Telos der Bildwissenschaft im Unterschied hierzu auf etwas anderes, Allgemeineres zielen sollte. Bildwissenschaft in diesem allgemeineren Sinn kann entsprechend als der Versuch verstanden werden, Bildsein und vor allem auch die Fähigkeit, mit Bildern umzugehen, zu bestimmen im Rahmen der Frage: Was ist Bildkompetenz? Der Fokus verschiebt sich dadurch insbesondere auf den Bildverwender. Der Ausdruck ›Bildkompetenz‹ steht hierbei bewusst in der Nähe zum Begriff der Sprachkompetenz, der durch Chomsky prominent geworden ist und bei dem unterstellt wird, dass es zumindest einige sehr allgemeine Strukturmerkmale gibt, die sich in allen natürlichen Sprachen finden lassen und diesen gleichsam zugrunde liegen. Die Wissenschaft mit dem Singular ›Bild‹ wäre dann analog zur allgemeinen Sprachwissenschaft dasjenige Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, unabhängig von konkreten Bildformen, Bildtypen oder Bildfunktionen die grundlegenden Strukturen bzw. Kompetenzen zu benennen und zu erforschen, die als Bedingung der spezifischen Bildverwendung gelten können bzw. sollten. Damit klingt natürlich die kantische bzw. neukantische Formulierung von der Bedingung der Möglichkeit von (in diesem Fall) Bilderfahrung an. Der vorliegende Sammelband umfasst Aufsätze, die genau dieser Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit von Bilderfahrung nachgehen – entweder indem sie aktuelle empirische Forschungen zu zentralen Fragen der Bildpsychologie vorstellen, etwa nach dem Verhältnis von Bildwahrnehmung und Gegenstandswahrnehmung, von Emotion und Bildrezeption oder von Bildrezeption und Aufmerksamkeit, oder indem sie sich reflexiv auf diese empirisch-bildpsychologischen Untersuchungen beziehen, um dadurch in einer stärker philosophischen und anthropologischen Perspektive die methodologischen Grundlagen einer 12 Klaus Sachs-Hombach / Rainer Totzke betrachterorientierten Bildwissenschaft als eines transdisziplinären Projekts herauszuarbeiten. Das Buch gliedert sich dabei in drei thematische Blöcke: Teil 1 widmet sich den erwähnten methodologisch-philosophischen Grundlagen der Bildwissenschaft. Teil 2 beinhaltet konkrete empirisch- psychologische Untersuchungen zur Bildrezeption. Teil 3 schließlich versammelt Beiträge, die sich eher Einzelaspekten und Anwendungen von Bildrezeptionsanalysen zuwenden. Die Idee und die Beiträge zum vorliegenden Buch Bilder – Sehen – Denken gehen auf die gleichnamige internationale Fachtagung zurück, die im März 2009 an der Technischen Universität Chemnitz stattfand und die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie der Technischen Universität Chemnitz gefördert wurde. Klaus Sachs-Hombach, Rainer Totzke Literatur Blum, G.; K. Sachs-Hombach; J. R. J. Schirr a: Kunsthistorische Bildanalyse und Allgemeine Bildwissenschaft. Eine Gegenüberstellung am konkreten Beispiel: Die Fotografie Terror of War von Nick Ut. In: Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft (Sonderheft 8: Ästhetik in metaphysikkritischen Zeiten. 100 Jahre »Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft«). Hamburg [Felix Meiner] 2007, 117 – 152 Br edekamp, H.: Bildwissenschaft. In: Metzler Lexikon Kunstwissenschaft. Stuttgart, Weimar [Metzler] 2003, 56 |
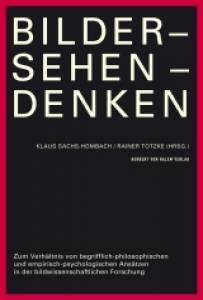
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen