|
|
|
Umschlagtext
Das bewährte Lehrbuch wurde in allen Teilen überarbeitet und ergänzt. Dabei waren einige gesetzliche Neuerungen zu berücksichtigen, darunter das Gesetz zur Änderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts sowie das Gesetz zur Selbstbestimmung hinsichtlich des Geschlechtseintrags. Ebenso berücksichtigt wurden neue Rechtsakte des Unionsrechts wie bspw. die Reparatur-Richtlinie und der Digital Services Act. Darüber hinaus wurden zahlreiche aktuelle gerichtliche Entscheidungen integriert. Der BGH äußerte sich zur Sittenwidrigkeit von (provozierten) Schenkungen, aber auch zu den Rechtsfolgen einer Unterverbriefung bei einem Grundstückskauf. Die Debatte um Künstliche Intelligenz (KI) und Autonome Systeme findet vor allem im Abschnitt über Rechtsgeschäfte und Willenserklärungen Berücksichtigung. Dabei werfen elektronische Willenserklärungen weiterhin spannende Fragen auf, etwa unter welchen Voraussetzungen und zu welchem Zeitpunkt solche Erklärungen dem Empfänger zugehen.
Rezension
Dieter Leipolds Lehrbuch “BGB I Einführung und Allgemeiner Teil” (in der 12. Auflage 2025) ist ein hervorragender Einstieg in das deutsche Zivilrecht.
In einfacher und leicht verständlicher Sprache bringt einem das Buch die Grundlagen des BGB näher. Der Aufbau ist schlüssig und fördert ein paralleles Erarbeiten der Inhalte zur Vorlesung. Neben optisch hervorgehobenen Merksätzen und Definitionen verfügt das Buch über einfache Schaubilder, die einem helfen, das Gelernte zu strukturieren. Das Buch ist in mehrere Abschnitte gegliedert. Auf eine kurze Einführung in die Grundlagen und die Grundbegriffe des Bürgerlichen Rechts folgt ein längerer Abschnitt über das Rechtsgeschäft und darauf einer über Rechtssubjekte. Anschließend wird über die Grenzen der Rechtsdurchsetzung und Sachenrecht aufgeklärt. Im dritten Teil erhält man Hinweise zur Arbeit mit dem BGB. Besonders der Abschnitt über den Gutachtenstil ist für Erstsemester hilfreich. Das Lehrbuch ist darauf ausgelegt, chronologisch bearbeitet zu werden. Durch die Definitionen und das Verzeichnis über die Abkürzungen kann es aber sicher auch als Nachschlagewerk genutzt werden. Persönlich fand ich “den Leipold”, sehr hilfreich. Themen, die in der Vorlesung nicht ausgiebig genug behandelt werden können, kann man mit ihm hervorragend nachlesen und so das eigene Wissen ergänzen. Die Erklärungen sind schlüssig und die Struktur des Buches machen es einem leicht, das eigene Lernen zu planen und das Wissen in Zusammenhang zu bringen. Nicht umsonst wurde uns das Buch bereits in der ersten Vorlesung vom Professor empfohlen. Ich bin sehr zufrieden und kann das Lob nur wiederholen. Leah S. Lussnig, Lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV
Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XX Erster Teil Einführung in das Bürgerliche Recht 1. Abschnitt: Grundlagen § 1 Das Bürgerliche Recht im Rahmen der gesamten Rechtsordnung . . . . . . . 1 I. Recht und Rechtsquellen – nationales und europäisches Recht . . . . . . 1 II. Grundrechte und Bürgerliches Recht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 III. Privatrecht und Öffentliches Recht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 IV. Das Bürgerliche Recht als Teilgebiet des Privatrechts . . . . . . . . . . . 13 V. Bürgerliches Recht und Strafrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 VI. Bürgerliches Recht und Verfahrensrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Kontrollfragen und Fälle zu § 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 § 2 Vorgeschichte und Entstehung des BGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 I. Die Wurzeln des deutschen Bürgerlichen Rechts . . . . . . . . . . . . . 19 II. Die Rechtslage vor Erlass des BGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 III. Das Streben nach Rechtsvereinheitlichung im 19. Jahrhundert . . . . . . 20 IV. Die Schaffung des BGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 § 3 System und rechtspolitische Grundlagen des BGB . . . . . . . . . . . . . . . 23 I. Aufbau und Regelungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 II. Das Verhältnis des BGB zum Landesrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 III. Gesetzesstil und rechtspolitische Grundlagen des BGB . . . . . . . . . 26 Kontrollfragen zu § 2 und § 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 § 4 Die Entwicklung des deutschen Bürgerlichen Rechts seit Erlass des BGB und die zunehmende Europäisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 I. Weitreichender Wandel durch gesetzliche Änderungen . . . . . . . . . 32 II. Neuschöpfungen der Rechtspraxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 III. Ein Rückblick: das Zivilrecht in der ehemaligen DDR . . . . . . . . . . 36 IV. Der starke Einfluss des Europäischen Rechts – das Europäische Privatrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 V. Digitalisierung und BGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 § 5 Methodische Hinweise zur Anwendung des Gesetzes . . . . . . . . . . . . . 42 I. Ziel der Gesetzesanwendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 II. Subsumtion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 III. Auslegung des Gesetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 IV. Analoge Anwendung gesetzlicher Vorschriften; gesetzesübersteigende Rechtsfortbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 VIII Inhalt V. Umkehrschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 VI. Teleologische Reduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2. Abschnitt: Grundbegriffe des Bürgerlichen Rechts § 6 Der schuldrechtliche Vertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 I. Vertragsfreiheit im Schuldrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 II. Wesensmerkmale am Beispiel eines Kaufvertrags . . . . . . . . . . . . 56 III. Die reguläre Erfüllung des Kaufvertrags . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 IV. Pflichtverletzungen (Leistungsstörungen) . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Kontrollfragen und Fälle zu § 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 § 7 Besitz und Eigentum sowie die Arten der subjektiven Rechte . . . . . . . . . 72 I. Der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum . . . . . . . . . . . . . 72 II. Der Inhalt des Eigentums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 III. Die wichtigsten Ansprüche aus dem Eigentum . . . . . . . . . . . . . . 74 IV. Der Erwerb des Eigentums an beweglichen Sachen . . . . . . . . . . . . 76 V. Der Erwerb des Eigentums an Grundstücken . . . . . . . . . . . . . . . 80 VI. Begriff und Arten der subjektiven Rechte . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Kontrollfragen und Fälle zu § 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 § 8 Das Abstraktionsprinzip und der Ausgleich nach den Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 I. Die Trennung zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft (Trennungsprinzip) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 II. Die Unabhängigkeit des Verfügungsgeschäfts vom Verpflichtungs- geschäft – der Inhalt des Abstraktionsprinzips . . . . . . . . . . . . . . 90 III. Der bereicherungsrechtliche Ausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 IV. Zur Bewertung des Abstraktionsprinzips . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Kontrollfragen und Fälle zu § 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 § 9 Unerlaubte Handlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 I. Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 II. Ansprüche aus § 823 Abs. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 III. Weitere Anspruchsgrundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Kontrollfragen und Fälle zu § 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Zweiter Teil Der Allgemeine Teil des BGB 1. Abschnitt: Das Rechtsgeschäft § 10 Rechtsgeschäft und Willenserklärung; Privatautonomie und Verbraucherschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 I. Das Rechtsgeschäft als Mittel zur Verwirklichung der Privatautonomie 108 II. Der Begriff des Rechtsgeschäfts und sein Verhältnis zur Willens- erklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 III. Die Willenserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 IXInhalt IV. Geschäftsähnliche Handlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 V. Realakte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 VI. Sozialtypisches Verhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 VII. Verbraucher und Unternehmer – die persönliche Reichweite des Verbraucherschutzes bei Rechtsgeschäften . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Kontrollfragen und Fälle zu § 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 § 11 Die Geschäftsfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 I. Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 II. Wichtige Abgrenzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 III. Die Geschäftsunfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 IV. Die beschränkte Geschäftsfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 V. Partielle Geschäftsfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 VI. Beweislast und maßgeblicher Zeitpunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 VII. Rechtliche Betreuung und Geschäftsfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . 159 VIII. Die Haftungsbeschränkung des Minderjährigen . . . . . . . . . . . . . 160 Kontrollfragen und Fälle zu § 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 § 12 Das Wirksamwerden von Willenserklärungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 I. Arten der Willenserklärungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 II. Nicht empfangsbedürftige Willenserklärungen . . . . . . . . . . . . . . 169 III. Empfangsbedürftige Willenserklärungen unter Abwesenden . . . . . . 170 IV. Empfangsbedürftige Willenserklärungen unter Anwesenden . . . . . . 180 V. Empfangsbedürftige Willenserklärungen gegenüber nicht voll geschäftsfähigen Personen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Kontrollfragen und Fälle zu § 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 § 13 Der Widerruf von Willenserklärungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 I. Die Regelung im Allgemeinen Teil des BGB . . . . . . . . . . . . . . . 186 II. Die neueren Widerrufsrechte zugunsten des Verbrauchers . . . . . . . . 188 Kontrollfragen und Fälle zu § 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 § 14 Der Abschluss eines Vertrages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 I. Die Unterscheidung von Angebot (Antrag) und Annahme . . . . . . . . 199 II. Das Angebot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 III. Die Annahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 IV. Besondere Gestaltungsformen: Vorvertrag und Optionsvertrag . . . . . 214 V. Vertragsschluss im Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 VI. Der Dissens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 VII. Vertragsschluss und Allgemeine Geschäftsbedingungen . . . . . . . . . 224 Kontrollfragen und Fälle zu § 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 § 15 Die Auslegung von Willenserklärungen und Verträgen . . . . . . . . . . . . 232 I. Das Ziel der Auslegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 II. Auslegungsgrundsätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 III. Die ergänzende Vertragsauslegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 IV. Übereinstimmende Falschbezeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Kontrollfragen und Fälle zu § 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 X Inhalt § 16 Formerfordernisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 I. Grundsatz der Formfreiheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 II. Gesetzliche Formvorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 III. Überwindung des Formmangels nach Treu und Glauben . . . . . . . . . 259 IV. Vereinbarte Form . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Kontrollfragen und Fälle zu § 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 § 17 Willensvorbehalte (bewusste Willensmängel) und Fehlen des Erklärungsbewusstseins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 I. Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 II. Der geheime Vorbehalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 III. Das Scheingeschäft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 IV. Die nicht ernstlich gemeinte Willenserklärung . . . . . . . . . . . . . . 272 V. Das Fehlen des Erklärungsbewusstseins . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Kontrollfragen und Fälle zu § 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 § 18 Die Anfechtung wegen Irrtums und unrichtiger Übermittlung . . . . . . . . 280 I. Die Anfechtbarkeit im Unterschied zur Nichtigkeit . . . . . . . . . . . . 280 II. Zweck und Grenzen der Irrtumsanfechtung . . . . . . . . . . . . . . . . 281 III. Die Anfechtungstatbestände des § 119 Abs. 1: Erklärungsirrtum (Irrtum in der Erklärungshandlung) und Inhaltsirrtum . . . . . . . . . . 283 IV. Der Eigenschaftsirrtum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 V. Die unrichtige Übermittlung einer Willenserklärung . . . . . . . . . . . 297 VI. Die Durchführung der Anfechtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 VII. Die Wirkungen der Anfechtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Kontrollfragen und Fälle zu § 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 § 19 Die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung und Drohung . . . . . . . . . . 309 I. Die arglistige Täuschung als Anfechtungsgrund . . . . . . . . . . . . . 309 II. Die Drohung als Anfechtungsgrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 III. Durchführung und Rechtsfolgen der Anfechtung wegen arglistiger Täuschung oder Drohung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 IV. Konkurrenzfragen, insbesondere Verhältnis zur culpa in contrahendo 322 Kontrollfragen und Fälle zu § 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 § 20 Gesetzlich verbotene, sittenwidrige und wucherische Rechtsgeschäfte . . . . 326 I. Gesetzlich verbotene Rechtsgeschäfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 II. Veräußerungsverbote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 III. Sittenwidrige Rechtsgeschäfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 IV. Wucherische und wucherähnliche Rechtsgeschäfte . . . . . . . . . . . . 344 Kontrollfragen und Fälle zu § 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 § 21 Die Aufrechterhaltung fehlerhafter Rechtsgeschäfte . . . . . . . . . . . . . . 353 I. Die Teilnichtigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 II. Die Umdeutung (Konversion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 III. Die Bestätigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Kontrollfragen und Fälle zu § 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 XIInhalt § 22 Bedeutung und Voraussetzungen der Stellvertretung . . . . . . . . . . . . . 366 I. Bedeutung und Begriff der Stellvertretung . . . . . . . . . . . . . . . . 366 II. Die Voraussetzungen wirksamer Stellvertretung . . . . . . . . . . . . . 373 Kontrollfragen und Fälle zu § 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 § 23 Gesetzliche Vertretungsmacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 I. Begriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 II. Fälle der gesetzlichen Vertretungsmacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 III. Gesetzliche Verpflichtungs- und Vertretungsmacht der Ehegatten . . . . 386 § 24 Die rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht (Vollmacht) . . . . . . . . . . . . 388 I. Erteilung der Vollmacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 II. Form der Vollmacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 III. Arten der Vollmacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 IV. Vollmacht und Grundgeschäft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 V. Erlöschen der Vollmacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 VI. Vollmacht kraft Rechtsscheins (gesetzliche Bestimmungen) . . . . . . . 398 VII. Duldungs- und Anscheinsvollmacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 VIII. Vollmacht und Anfechtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Kontrollfragen und Fälle zu § 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 § 25 Wirkungen der Stellvertretung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 I. Wirkungen des vom Vertreter abgeschlossenen Rechtsgeschäfts . . . . 408 II. Willensmängel und Kenntnis von Umständen bei der Vertretung . . . . 410 Kontrollfragen und Fälle zu § 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 § 26 Das Handeln eines Vertreters ohne Vertretungsmacht . . . . . . . . . . . . . 417 I. Das ohne Vertretungsmacht abgeschlossene Rechtsgeschäft . . . . . . . 417 II. Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht . . . . . . . . . . . . . . 420 III. Haftung bei mehrstufiger Vertretung (Untervollmacht) . . . . . . . . . 424 Kontrollfragen und Fälle zu § 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 § 27 Das Insichgeschäft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 I. Begriff des Insichgeschäfts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 II. Grundsätzliche Unwirksamkeit von Insichgeschäften . . . . . . . . . . 431 III. Gesetzliche Ausnahmen vom Verbot des Insichgeschäfts . . . . . . . . 432 IV. Ungeschriebene Ausnahme für lediglich rechtlich vorteilhafte Geschäfte 433 V. Analoge Anwendung des § 181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Kontrollfragen und Fälle zu § 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 § 28 Verfügungen eines Nichtberechtigten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 I. Begriffsmerkmale der Verfügung eines Nichtberechtigten . . . . . . . . 438 II. Wirksamkeitsvoraussetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 III. Einziehungsermächtigung und Prozessführungsermächtigung . . . . . 442 IV. Unzulässigkeit einer Verpflichtungsermächtigung . . . . . . . . . . . . 443 Kontrollfragen und Fälle zu § 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 XII Inhalt § 29 Bedingte und befristete Rechtsgeschäfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 I. Begriff der Bedingung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 II. Arten und Wirkungen der Bedingung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 III. Zulässigkeit der Bedingung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 IV. Schutzvorschriften für die Schwebezeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 V. Befristete Rechtsgeschäfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Kontrollfragen und Fälle zu § 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 2. Abschnitt: Die Rechtssubjekte § 30 Die Arten der Rechtssubjekte und die Rechtsfähigkeit des Menschen . . . . 456 I. Begriff der Rechtsfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 II. Arten der Rechtssubjekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 III. Der Beginn der Rechtsfähigkeit des Menschen . . . . . . . . . . . . . . 458 IV. Das Ende der Rechtsfähigkeit des Menschen . . . . . . . . . . . . . . . 460 Kontrollfragen und Fälle zu § 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 § 31 Juristische Personen, insbesondere der eingetragene Verein, sowie rechtsfähige Personengesellschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 I. Funktion, Begriff und Arten der juristischen Person . . . . . . . . . . . 465 II. Rechtsfähige Personengesellschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 III. Andere Gemeinschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 IV. Der rechtsfähige Verein (Verein mit Rechtspersönlichkeit) . . . . . . . . 469 V. Organe des Vereins und Haftung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 VI. Mitgliedschaft und Vereinsautonomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 VII. Die Beendigung des Vereins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 VIII. Die rechtsfähige Stiftung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 IX. Haftung juristischer Personen des öffentlichen Rechts . . . . . . . . . . 486 Kontrollfragen und Fälle zu § 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 § 32 Der nicht eingetragene Verein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 I. Ursprüngliche Regelung im BGB und weitere Entwicklung . . . . . . . 490 II. Neuregelung durch das MoPeG 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 III. Keine Haftung der Mitglieder eines nicht eingetragenen Idealvereins für Vereinsverbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 IV. Haftung des für den nicht eingetragenen Verein Handelnden . . . . . . 492 § 33 Namensrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 I. Der Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 II. Funktionen und Schutz des Namens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 III. Erweiterter Anwendungsbereich des § 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Kontrollfragen und Fälle zu § 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 § 34 Der Wohnsitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 I. Bedeutung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 II. Begründung und Aufhebung des Wohnsitzes . . . . . . . . . . . . . . . 506 XIIIInhalt 3. Abschnitt: Grenzen der Rechtsdurchsetzung § 35 Die Verjährung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 I. Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 II. Die Verjährungsfristen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 III. Die Wirkung der Verjährung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 IV. Hemmung, Ablaufhemmung und Neubeginn der Verjährung . . . . . . 518 V. Die Verwirkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 Kontrollfragen und Fälle zu § 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 § 36 Regeln der Rechtsausübung: Schikaneverbot, Notwehr, Notstand und Selbsthilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 I. Unzulässige Rechtsausübung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 II. Notwehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 III. Defensiv- und Aggressivnotstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 IV. Selbsthilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 Kontrollfragen und Fälle zu § 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 § 37 Berechnung von Fristen und Terminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 I. Inhalt und Geltungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 II. Berechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 III. Weitere Auslegungsregeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 IV. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Hinweis) . . . . . . . . . . . . 537 4. Abschnitt: Sachen § 38 Sachen, Bestandteile, Zubehör und Nutzungen . . . . . . . . . . . . . . . . 538 I. Bedeutung des Gesetzesabschnitts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 II. Begriff und Arten der Sachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 III. Sachbestandteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 IV. Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 V. Nutzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 Kontrollfragen und Fälle zu § 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 Dritter Teil Arbeitshinweise § 39 Hinweise zur schriftlichen Bearbeitung zivilrechtlicher Fälle . . . . . . . . . 552 I. Vorbemerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 II. Schritte der Bearbeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 III. Bedeutung des Sachverhalts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 IV. Ansprüche und Anspruchsgrundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 V. Aufbau (Gliederung) und Überschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 VI. Gutachtenstil und Sprache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 § 40 Definitionen, die man sich einprägen sollte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Paragraphenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 Sachregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 |
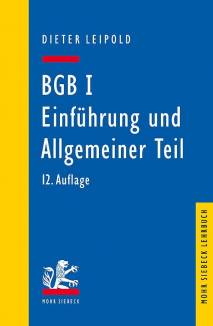
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen