|
|
|
Umschlagtext
Glauben heißt vertrauen, aber auch: sich auseinandersetzen. Glaubende stellen Fragen, prüfen Antworten und gewinnen dabei Einsichten, die ihnen helfen, ihr Leben tiefer zu verstehen. In der Begegnung mit Atheismus, Pseudoreligiosität, konkurrierenden Religionen und eigenen Zweifeln machen sie Erfahrungen, die sie miteinander teilen und an andere weitergeben können. Auf diese Weise vollzieht sich ein Prozess, in dem sie lernen, mit theologischen Schwierigkeiten umzugehen und unkonventionelle eigene Antworten zu wagen. Damit ändert sich zugleich das Selbstverständnis des Christentums insgesamt: Traditionelle dogmatische Aussagen und ethische Grundsätze erscheinen in einem neuen Licht.
In fünf thematischen Abschnitten versammelt dieser Band z.T. bisher unveröffentlichte Aufsätze zum Thema »Glauben« in christlicher und interreligiöser Perspektive. Hans-Martin Barth, geb. 1939, Dr. theol., ist Professor em. für Systematische Theologie und Religionsphilosophie am Fachbereich Evangelische Theologie der Philipps-Universität Marburg. Rezension
In evangelischer Perspektive ist der Glaube wie die Kirche "semper reformanda", d.h. ständig zu reformieren, ständig in Frage zu stellen, ständig in Zweifel zu ziehen. Deshalb hat der protestantische Theologe Paul Tillich im 20. Jhdt. von der Rechtfertigung des Zweiflers anstelle der Rechtfertigung des Sünders gesprochen. Glaube muss lebendiger, d.h. herausgeforderter Glaube sein, der sich stets authentisch neu finden muss: Authentisch glauben! (Titel). Dazu bedarf es steter Impulse zu einem neuen Selbstverständnis des Christentums (Untertitel), die der Autor in der Begegnung mit Atheismus, Pseudoreligiosität, konkurrierenden Religionen und eigenen Zweifeln findet. Den Autor bewegt vor allem die Frage, wie sich die Gestalt des christlichen Glaubens verändern muss, damit er sich nicht selber im Weg steht.
Thomas Bernhard, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Impulse zu einem neuen Selbstverständnis des Christentums Inhaltsverzeichnis
Vorwort 5
A. Nachdenklicher Glaube 1. Glaube als Projektion 15 1.1 Die Aussagen der Projektionstheorie über den Glauben 19 1.2 Traditionelle theologische Bedenken gegenüber der Projektionstheorie 25 1.3 Die Wirklichkeit des Glaubens als Wirklichkeit von Projektion 30 2. Alpha- und Omega-Glaube: Glaubensbewusstheit 37 2.1 Christliches Glaubensbewusstsein 38 2.2 Buddhistische Auffassungen von »Glaube« 41 2.3 Trinitarisch bedingte Bewusstseinsebenen 45 2.4 Glaubensbewusstheit 48 3. »Brauchbare Hilfen« für Glaube und Leben 52 3.1 upaya 53 3.2 Heilsmittel 59 3.3 Brauchbare Hilfen 62 4. Zwischen Aporie und erstrebter Plausibilität. Christologie zu Beginn des 21. Jahrhunderts 69 4.1 Die Sprache der christologischen Hoheitstitel im Neuen Testament 70 4.2 Die Zweinaturenlehre 73 4.3 Das Theismus-Problem 78 4.4 Plausible Christologie 82 4.5 Verzicht auf Begründung, nicht auf Plausibilisierung 86 5. Abschied von der Dominanz der Inkarnationschristologie 88 5.1 Die Verabschiedungsproblematik 89 5.2 Die Suche nach Alternativen 92 5.3 Offene Fragen 98 5.4 Verlust-Ängste 102 5.5 Gewinne 104 6. Plausibilität statt überholter Metaphysik 106 6.1 Rehellenisierung oder Enthellenisierung der christlichen Theologie? 107 6.2 Philosophische Implikationen nichtchristlicher Religionen 110 6.3 Befreiung der christlichen Theologie aus metaphysischer Gefangenschaft 116 B. Glaube im Vollzug 1. Angesichts des Leidens von Gott reden 129 1.1 Glaube an den allmächtigen Gott? 130 1.2 Glaube an den verborgenen Gott? 132 1.3 Glaube an den dreifaltig sich verwirklichenden Gott 137 1.4 Die therapeutische Funktion der Rede von Gottes Selbstverwirklichung 144 2. Die Selbstverwirklichung Gottes und der Menschen 147 2.1 Gottes Wirklichkeit heißt: Leben gewähren 149 2.2 Menschlich leben heißt: Gottes Wirklichkeit in Anspruch nehmen 154 3. Rechtfertigung und Identität 159 3.1 Einwände gegen eine anthropologische Interpretation der Rechtfertigungsbotschaft 161 3.2 Personale Identität 164 3.3 Personale Rechtfertigung 167 3.4 Für eine Neufassung der Rechtfertigungslehre 171 4. Das Ich/Nicht-Ich des Glaubens 175 4.1 Exegetische Beobachtungen 176 4.2 Religionsphilosophische Zwischenüberlegung 180 4.3 Theologische Würdigung 183 5. Wert des Glaubens – Glaube als Wert 191 5.1 Die Ambivalenz des Glaubens 193 5.2 Die Transzendenz des Glaubens 196 5.3 Die Relevanz des Glaubens 202 C. Inspirierender Glaube 1. Verschwenden – eine theologische Kategorie? 211 1.1 Mensch sein heißt: verschwenden können 212 1.2 Gottes Gottheit: Gott verschwendet sich? 214 1.3 Gott verschwendet sich dreifaltig, aber die Christen reagieren einfältig 217 1.4 Christliche Existenz: aus dem Vollen schöpfen 220 2. Sinnverzicht und Sinnverlangen 223 2.1 Der Sinn der Rede von Sinn 224 2.2 Zwischen philosophischer Begründung und Bestreitung von Sinn 225 2.3 Sinnerfahrungen 228 2.4 Die Sinnfrage im Horizont des christlichen Glaubens 233 3. Wege aus der Krise des Gebets 239 3.1 Schwierigkeiten akzeptieren und reflektieren 240 3.2 Lösungsansätze wahrnehmen und sichten 244 3.3 Das Gebet aufkommen lassen 249 4. Allein durch den Glauben 255 4.1 Das Woher des Glaubens 256 4.2 Das Woraufhin des Glaubens 258 4.3 Glaube als metaphänomenales Phänomen 260 5. Domestizierende Lehre contra anarchische Spiritualität? 263 5.1 Zur Definition von »Spiritualität« und »Lehre« 263 5.2 Modelle der Verhältnisbestimmung von Spiritualität und Lehre 264 5.3 Konsequenzen für die Ökumene 270 D. Glaube in Konfrontation 1. Die Vielfalt der Religionen und der eine Gott 277 1.1 Die religionswissenschaftliche Perspektive 278 1.2 Theologische Klärungsversuche 284 1.3 Die Vielfalt der Religionen als vestigium trinitatis 291 2. Shin-Buddhismus und evangelischer Glaube 295 2.1 Amida und der Gott Jesu Christi 295 2.2 Gottes Selbstvergegenwärtigung 297 2.3 Die Provokation des Kreuzes 300 2.4 Stellvertretende Versöhnung? 301 2.5 Konsequenzen für die Ethik 302 2.6 Die Begrenztheit soteriologischer Anthropozentrik 304 3. Die Wahrheitsfrage im christlich-islamischen Dialog 307 3.1 Die Vielfalt von Wahrheitsbegriffen 308 3.2 Die Problematik des an Satzwahrheiten orientierten Wahrheitsbegriffs 312 3.3 Der an Existenzwahrheit orientierte Wahrheitsbegriff 314 3.4 Satz- und Existenzwahrheit im christlich-islamischen Dialog 320 3.5 Die Vermittlung von Wahrheitsgewissheit 322 4. Die Legitimität christlicher Mission im Zeitalter der Globalisierung 326 4.1 Obsolet gewordene Modelle der Begründung christlicher Missionstätigkeit 328 4.2 Mission in der Situation des Pluralismus 331 4.3 Christologisch orientierte Konzeptionen 333 4.4 Pneumatologische Ansätze 336 4.5 Der dreieine Gott und der missionarische Auftrag der Christenheit 338 E. Lernbereiter Glaube 1. Das Wesen des Christentums und die Ökumene der Kirchen 347 1.1 Wesen des Christentums statt Ökumene der Kirchen? 347 1.2 Wesen des Christentums in der Ökumene der Kirchen? 350 1.3 Ökumene auf dem Weg zu einer neuen Gestaltwerdung des Christentums 353 2. Feuerbach und die Mystik 357 2.1 »Mystische Phase« Feuerbachs oder: Feuerbach – ein »Mystiker«? 358 2.2 Feuerbachs Interpretation von »Mystik« 361 2.3 Die philosophische und theologische Bedeutung von Feuerbachs Mystik-Verständnis 370 3. Du, Gott, bist nur dir bekannt! Islamische Mystik im Urteil des evangelischen Erweckungstheologen August Tholuck 374 3.1 Philologie versus Theologie 375 3.2 Auseinandersetzung mit islamischer Mystik 378 3.3 Islamische Mystik und der evangelische Glaube 383 Anhang Nachweise 397 Ergänzende Bibliographie 2005 bis 2010 399 Register Bibelstellen 405 Namen 407 Begriffe 413 Leseprobe: Vorwort Glauben heißt vertrauen, aber auch: sich auseinandersetzen. Glaubende stellen Fragen, prüfen Antworten und gewinnen dabei Einsichten, die ihnen helfen, ihr Leben tiefer zu verstehen. In der Begegnung mit Atheismus, Pseudoreligiosität, konkurrierenden Religionen und eigenen Zweifeln machen sie Erfahrungen, die sie mit einander teilen und an andere weitergeben können. Auf diese Weise vollzieht sich ein Prozess, in dem sie lernen, mit theologischen Schwierigkeiten umzugehen und unkonventionelle eigene Antworten zu wagen. Damit ändert sich zugleich das Selbstverständnis des Christentums insgesamt: Traditionelle dogmatische Aussagen und ethische Grundsätze erscheinen in einem neuen Licht. Die von mir vorgelegten Bände »Dogmatik. Evangelischer Glaube im Kontext der Weltreligionen« und »Die Theologie Martin Luthers. Eine kritische Würdigung« sind zwar reichlich voluminös ausgefallen. Beide Bücher boten gleichwohl nicht Raum genug, alles zu sagen, was mir wichtig war und was ich sagen möchte. Gern nehme ich daher die Gelegenheit wahr, eine Reihe von teils publizierten, teils noch nicht veröffentlichten Arbeiten zusammenzustellen. Sie ergänzen den Band »Begegnung wagen – Gemeinschaft suchen« (Göttingen 2000), in dem meine bis dahin erschienen Beiträge zur ökumenischen Theologie gebündelt sind. Wer sich nach einem authentischen Glauben sehnt, bejaht die durch seine Konstitution und seine Sozialisation bedingten Grenzen seines Verstehens und versucht doch, sie zu erweitern oder gar zu durchstoßen. Er will verstehen, was er liest (vgl. Apg 8,30), und weiß zugleich, dass der Glaube »höher ist als alle Vernunft«. »Authentisch glauben« war und ist mein Lebensthema. Seit meinem Studium in Erlangen, Rom und Heidelberg, dann herausgefordert durch die Tod Gottes-Theologie an der Harvard Divinity School, später, in neuer Fassung angesichts des Clinical Pastoral Training, beschäftigt mich die Frage, wie christlicher Glaube – in den jeweils gegebenen Grenzen – authentisch vertreten und gelebt werden kann. Vielfältige Begegnungen innerhalb der christlichen Ökumene und schließlich mit nichtchristlichen Religionen machten mir das Problem erneut dringlich. Heute bewegt mich vor allem die Frage, wie sich die Gestalt des christlichen Glaubens verändern muss, damit er sich nicht 6 selber im Weg steht. In diesem Sinn suche ich nach Impulsen zu einem neuen Selbstverständnis des Christentums. Mir kommen die Männer und Frauen in den Sinn, die mir geholfen haben, Zugang zum christlichen Glauben zu finden, allen voran meine Eltern. Bestärkt haben mich immer wieder ungewöhnliche Menschen, denen ich begegnet bin, der Thalmässinger lutherische Dekan Friedrich Graf, unter meinen Professoren Paul Althaus und mein Doktorvater Wilhelm Maurer, der waldensische Kirchenhistoriker Valdo Vinay und sein Kollege Paolo Ricca, und nicht zuletzt meine Lektorin, Gesprächspartnerin und Beraterin in allen Lebensfragen: meine Ehefrau. Ihnen und vielen anderen, die meinen Weg gekreuzt und mitbestimmt haben, bin ich daher von Herzen dankbar. Schwerer fällt es mir, nach Luthers Anweisung auch meinen Widersachern dankbar zu sein, die mir doch phasenweise das Leben schwer machten; aber auch sie werden ihre Verdienste an meinem theologischen Nachdenken haben. Zweimal wurden Beiträge aus meiner Werkstatt vom Herausgeber einer wichtigen theologischen Fachzeitschrift abgelehnt; sie waren nicht »orthodox« genug. Auch in dem vorliegenden Band dürfte manches als nicht »orthodox« erscheinen. Es handelt sich um Denkvorschläge, die aber vielleicht doch dem einen oder der anderen helfen, mit dem christlichen Glauben besser klar zu kommen. Ich scheue mich nicht, den schon sehr lange zurückliegenden Artikel »Glaube als Projektion«, meine Habilitations-Probevorlesung, noch einmal abzudrucken, obwohl er sich in der durch die Esoterik und die Präsenz nichtchristlicher Religionen religiös aufgeschlossenen Atmosphäre heute eher fremd ausnehmen mag. Ich halte Feuerbach für eine bleibende Herausforderung des Christentums, ja der Religion überhaupt. Unter der Rubrik »Nachdenklicher Glaube« ergänze ich die in meiner Dogmatik angesichts von deren spezifischer Zielsetzung zu kurz ausgefallenen Prolegomena nun durch eine Reihe von »Paralegomena«. Zugleich möchte ich an einigen Beispielen zeigen, wie Glaube inspiriert und sich vollzieht, und wie er sich in der Konfrontation mit alternativen Auffassungen darstellt. In technischer Hinsicht hilfreich waren mir wieder Diedrich Steen, Programmleiter und Lektor beim Gütersloher Verlag, kompetent unterstützt durch seine Mitarbeiterin Frau Tanja Scheifele, sowie Frau Inge Radparvar, die seit nunmehr 26 Jahren mit großem Engagement und höchster Aufmerksamkeit sich um die Reinschrift meiner Manuskripte bemüht. Bei der Gestaltung des Covers hat mich mein vielseitig versierter Bruder Reiner Barth fachkundig beraten. Marburg, in der Adventszeit 2009 Hans-Martin Barth |
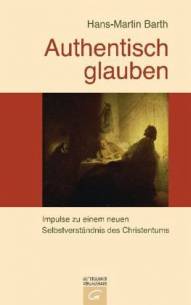
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen