|
|
|
Umschlagtext
Die zentralen ethischen Fragen am Anfang und Ende des Lebens
Ethische Grundfragen der Medizin gehören zu den zentralen Themen der Theologischen Ethik. Einen Schwerpunkt bilden dabei die brisanten Fragen nach einem verantwortlichen Umgang mit den medizinischen Möglichkeiten am Anfang und Ende des menschlichen Lebens, z. B. Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik, Genome Editing, Schwangerschaftsabbruch, Sterbehilfe und Assistierter Suizid. Stephan Ernst bietet hier kompetente Handlungsorientierung. Er greift das Prinzip der Verhältnismäßigkeit als zentrales Kriterium ethischer Entscheidungen auf, das in der Praxis verantwortlichen Handelns von Ärzten und Pflegern immer schon leitend ist. So wird es möglich, Entscheidungen in der Medizin zu treffen, die starre prinzipielle Verbote aufbrechen und den realen Situationen und Menschen in ihrer Vielfalt und Individualität gerecht werden, ohne in eine kriterienlose Beliebigkeit zu verfallen. Stephan Ernst, geb. 1956, studierte kath. Theologie, Philosophie, Pädagogik und Musikwissenschaft in Frankfurt am Main und Münster. Er promovierte 1986 im Fach Dogmatik bei Peter Hünermann in Tübingen. Von 1987 bis 1999 war er in der religiös-theologischen Erwachsenenbildung im Erzbistum Paderborn tätig, von 1990 bis 1993 Stipendiat der Fritz-Thyssen-Stiftung. 1995 erfolgte die Habilitation in Tübingen für das Fach "Theologische Ethik". Seit April 1999 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Theologische Ethik - Moraltheologie an der Katholisch-theologischen Fakultät der Universität Würzburg. Rezension
Insbesondere am Anfang und am Ende des menschlichen Lebens verschieben sich die Grenzen und eröffnen sich völlig neue bio-medizinisch-technische Optionen, die Grundfragen medizinischer Ethik neu stellen. Zwischen Schwangerschaftsabbruch und Sterbehilfe sind ethische Problembereiche angesiedelt, die ethischer Zuwendung dringend bedürfen: Embryonenforschung, Hirntod, Bioethik, Genomanalyse und Gentechnik etc. Die Medizin- und die Bio-Ethik stellen womöglich die größten ethischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts dar; denn der Mensch scheint in der Tat vom Geschöpf zum Schöpfer zu mutieren. Die technischen Möglichkeiten wachsen in einem Ausmaß, das ethisch kaum mehr hinreichend begleitet werden kann. Die Grenzen des Lebens am Anfang und Ende stehen ebenso zur Disposition wie die Frage, was überhaupt Leben oder Tod ist, welche genetischen Forschungen zugelassen und zugemutet werden können, wie sich Tötungsverbot und Sterbehilfe angesichts technischer Verzögerung des Todes ausgleichen lassen etc. Es ist dringend geboten, medizinethische Fragestellungen in einer breiteren Öffentlichkeit einem gesamtgesellschaftlichen Diskurs zuzuführen. Schulischer Ethik-, Gesellschaftskunde- und Religionsunterricht sollte sich dieser Herausforderung verstärkt stellen. Das vorliegende Buch ist als Einführung in Grundfragen der medizinischen Ethik aus theologisch-ethischer Sicht gedacht. Die vorliegende Einführung konzentriert sich in der Fülle der Problemfelder lediglich auf zentrale Fragen am Anfang und am Ende des menschlichen Lebens, und auch diese können nur in einigen wichtigen Aspekten beleuchtet werden.
Jens Walter, lehrerbibliothek.de Verlagsinfo
Mit einem Exkurs zur Corona-Krise Wege zu einer verantwortlichen Entscheidungsfindung Innovativer, praxisnaher Ansatz Inhaltsverzeichnis
Vorwort 11
Einführung: Aufgabe und Vorgehen einer Medizinethik aus theologisch-ethischer Sicht 15 1. Herausforderungen an eine Medizinethik aus theologischethischer Sicht 16 2. Selbstverständnis der vorliegenden theologischen Ethik 20 3. Vorgehen einer Medizinethik aus theologisch-ethischer Sicht 25 Grundlegung: Verhältnismäßigkeit als Grundprinzip der medizinischen Ethik 29 1. Der Ruf nach Ethik in der Medizin 29 2. Skepsis gegenüber einheitlichen prinzipienethischen Begründungsansätzen 33 3. Die vier medizinethischen Prinzipien 37 4. Probleme der vier medizinethischen Prinzipien 40 5. Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit 43 5.1 Zugang aus der Praxis 43 5.2 Ausgangspunkt: Die Ambivalenz menschlichen Handelns 45 5.3 Präzisierung des Prinzips „Verhältnismäßigkeit“ 47 5.4 Situationsgerechtigkeit und Unbeliebigkeit ethischer Entscheidungen 49 6. Interpretation der vier medizinethischen Prinzipien vom Prinzip der Verhältnismäßigkeit 50 6.1 Nicht schaden (Non-maleficence) 51 6.2 Wohltun und Fürsorge (beneficence) 55 6.3 Respekt vor der Autonomie (autonomy) 57 6.4 Gerechtigkeit (justice) 61 7. Zum Zusammenhang der vier medizinethischen Prinzipien 67 8. Exkurs: Verhältnismäßigkeit als Prinzip verantwortlicher Entscheidungen am Beispiel der Corona-Krise 68 8.1 Das zentrale Dilemma 69 8.2 Auf der Suche nach einer angemessenen Bewältigung der Krise 72 9. Schuld und Tragik – Krankheit und Schuld 76 Erster Teil: Ethische Fragen am Ende des Lebens 83 1. Strikte Ablehnung der Tötung auf Verlangen 85 1.1 Formen der Sterbehilfe und begriffliche Abgrenzungen 85 1.2 Rechtliche Regelungen in Deutschland: Grundlagen und Einwände 87 1.2.1 Strafrechtliche Bestimmungen 87 1.2.2 Standesrechtliche Grundsätze 89 1.2.3 Menschenwürde und Lebensschutz als Grundlage 90 1.2.4 Anfragen und Einwände 92 1.3 Die Position der katholischen Kirche: Argumente und Anfragen 95 1.3.1 Theologische Begründung des Tötungsverbots als Grundlage 95 1.3.2 Säkulare und theologische Einwände 99 2. Bedingte Befürwortung der Tötung auf Verlangen 103 2.1 Zwei Fälle als Diskussionsgrundlage 103 2.2 Die rechtliche Regelung in den Niederlanden 105 2.2.1 Bestimmungen und Ziele 105 2.2.2 Gefahr des Dammbruchs? 107 2.3 Autonomie und Lebensqualität als Kriterien 110 2.3.1 Freiheit und Selbstbestimmung als Grundwerte 111 2.3.2 Grenzen der Selbstbestimmung? 114 2.4 Nicht-intrinsische, interessensbasierte Begründungen des Tötungsverbots 116 2.4.1 Modelle der Begründung 117 2.4.2 Bleibendes Unbehagen 120 3. Verhältnismäßigkeit wahren: Sterbehilfe und Palliativmedizin 122 3.1 Ausnahmen vom Tötungsverbot – Logik der Begründung 123 3.2 Konsequenzen für die Beurteilung der Sterbehilfe 131 3.2.1 Zum Ziel ärztlichen Handelns 131 3.2.2 Begründung des Behandlungsverzichts und Behandlungsabbruchs 133 3.2.3 Abbruch künstlicher Ernährung 135 3.2.4 Begründung der indirekten Sterbehilfe 138 3.2.5 Tötung auf Verlangen oder Palliativmedizin? 140 3.3 Bleibende Fragen 144 4. Zentrale Bedeutung des Patientenwillens 146 4.1 Die gesetzliche Regelung der Patientenverfügung 148 4.2 Absicherung der Patienten-Autonomie 151 4.3 Die Frage der Reichweitenbegrenzung 153 4.4 Die Empfehlung umfassender Beratung 159 4.4.1 Die Möglichkeit „negativer Selbstbindung“ 160 4.4.2 Eingehende medizinische Beratung als Hilfe zur Selbstbestimmung 161 4.4.3 Advance Care Planning – Behandlung im Voraus planen 163 4.4.4 Weitere Beratung mit Vertrauenspersonen 165 4.5 Wenn kein Patientenwille vorliegen kann: Entscheidungen in der Neonatologie 166 4.5.1 Rechtlicher Rahmen, Empfehlungen und Leitlinien 167 4.5.2 Ethische Orientierungspunkte 170 5. Assistierter Suizid und Sterbefasten 175 5.1 Rechtliche Regelung des assistierten Suizids in Deutschland 176 5.2 Gründe für eine ethische Legitimierung der Suizidbeihilfe 181 5.3 Theologisch-ethische Überlegungen 185 5.3.1 Das strikte Verbot der Suizidbeihilfe: Wie tragfähig sind die Gründe? 185 5.3.2 Die Unterscheidung von Respektieren und Gutheißen 188 5.3.3 Die Frage der Verhältnismäßigkeit 193 5.3.4 Die Frage erlaubter und unerlaubter Mitwirkung 196 5.4 Sterbefasten 201 5.4.1 Ist Sterbefasten Suizid? 201 5.4.2 Ist die pflegerische Versorgung beim Sterbefasten Mitwirkung am Suizid? 203 6. Organspende und Hirntod 204 6.1 Organspende – Zeichen von Solidarität und Nächstenliebe 205 6.2 Ethische Fragen bei Lebendspende und postmortaler Organspende 208 6.3 Ist der Hirntod der Tod desMenschen? 212 6.3.1 Rechtliche, standesrechtliche und kirchliche Position 212 6.3.2 Ursprung des Hirntod-Kriteriums 215 6.3.3 Gegensätzliche Kritik am Hirntod-Kriterium 216 6.3.4 Begründung des Ganzhirntods als Tod des Menschen 219 6.3.5 Neue Zweifel und Diskussion des Hirntod-Kriteriums 221 6.3.6 Konsequenzen 224 6.4 Zustimmungs- oder Widerspruchsregelung? 226 6.4.1 Zahlen und Entwicklungen 226 6.4.2 Die Frage der gesetzlichen Regelung – Deutschland im europäischen Vergleich 228 6.4.3 Ethische Diskussion und Begründung 230 Zweiter Teil: Ethische Fragen am Anfang des Lebens 234 1. Der moralische Status des menschlichen Embryos 236 1.1 Zwei Vorbemerkungen 237 1.2 Erste Frage: Kommt allen Menschen Menschenwürde und Lebensrecht zu? 239 1.2.1 Position: Nicht allen Menschen kommt Personsein und Schutzwürdigkeit zu 239 1.2.2 Argumente für die Menschenwürde und Schutzwürdigkeit aller Menschen 242 1.3 Zweite Frage: Wann liegt ein menschliches Individuum vor? 246 1.3.1 Menschsein vom Moment der Befruchtung an 246 1.3.2 Menschsein ab der Nidation 250 1.3.3 Weitere Zeitpunkte für den Beginn des menschlichen Individuums 253 1.3.4 Die Bedeutung epigenetischer Faktoren für die Embryonalentwicklung 255 1.4 Fazit: Tutiorismus und Verhältnismäßigkeit 259 2. Stammzellforschung 261 2.1 Stammzellforschung – Stammzelltherapie – Embryonenverbrauch 261 2.1.1 Grundlagen und Ziele der Stammzellforschung 261 2.1.2 Möglichkeiten der Stammzellgewinnung 263 2.2 Positionen zur Forschung mit embryonalen Stammzellen in Deutschland 266 2.2.1 Die rechtliche Regelung in Deutschland und die Position der Kirchen 266 2.2.2 Argumente für die Forschung auch in Deutschland 268 2.2.3 Stichtagslösung und Stichtagsverschiebung 269 2.3 Überlegungen zur ethischen Bewertung der Stichtagsregelung 272 2.3.1 Stammzellimport als Mitwirkung am Embryonenverbrauch? 272 2.3.2 Stichtagsverschiebung – eine Farce? 276 2.4 Embryonenschutz und Stammzellforschung 278 3. Technisch assistierte Reproduktion 279 3.1 Methoden der technisch assistierten Reproduktion 280 3.2 Die rechtliche Situation in Deutschland 283 3.3 Die Position der Kirchen 285 3.4 Theologisch-ethische Diskussion der technisch assistierten Reproduktion 289 3.4.1 Anfragen an das lehramtliche Verbot homologer IVF und seine Begründung 289 3.4.2 Ethisch relevante Folgeprobleme der künstlichen Befruchtung 293 3.5 Embryonenspende und Embryonenadoption 294 3.5.1 Gründe für die Embryonenspende 295 3.5.2 Rechtliche Fragen 297 3.5.3 Theologisch-ethische Diskussionen 298 3.5.4 Was dennoch zu bedenken ist 302 3.5.5 Fazit 306 3.6 Social Freezing 307 4. Schwangerschaftsabbruch 310 4.1 Ethische und rechtliche Aspekte des Schwangerschaftsabbruchs 311 4.1.1 Die Position der katholischen Kirche und ihre Problematik 312 4.1.2 Die rechtliche Regelung in Deutschland 315 4.1.3 Theologisch-ethische Würdigung der rechtlichen Regelung 319 4.2 Schwangerschaftskonfliktberatung in katholischen Einrichtungen 323 4.3 Empfängnisverhütung 328 4.4 Sterilisierung 332 4.5 Die „Pille danach“ 335 5. Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik 338 5.1 Methoden der Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik 338 5.2 Überlegungen zur ethischen Bewertung der Pränataldiagnostik 344 5.2.1 Chancen der Pränataldiagnostik 344 5.2.2 Ethisch herausfordernde Nebenfolgen 346 5.2.3 Konsequenzen: Reproduktive Autonomie mithilfe von Beratung 351 5.3 Rechtliche Regelung der Pränataldiagnostik: Das Gendiagnostik-Gesetz 352 5.4 Ethische Überlegungen zum Nicht-invasiven Pränataltest 354 5.5 Überlegungen zur ethischen Bewertung der Präimplantationsdiagnostik 358 5.5.1 Befürwortende Argumente 358 5.5.2 Ethische Bedenken 359 5.6 Zur rechtlichen Regelung der Präimplantationsdiagnostik 360 5.7 Ethische Überlegungen zur rechtlichen Regelung der Präimplantationsdiagnostik 363 6. Genome Editing und genetisches Enhancement 367 6.1 Genome Editing – Grundlagen, Methode, Ziele 367 6.2 Selbstperfektionierung oder Hybris? 369 6.3 Therapeutische Anwendungsmöglichkeiten und ihre ethische Bewertung 372 6.3.1 Somatische Gentherapie 373 6.3.2 Keimbahn-Gentherapie 375 6.4 Möglichkeiten des Enhancements und ihre ethische Bewertung 380 6.4.1 Das Argument: Recht auf Naturwüchsigkeit 380 6.4.2 Argumente unter Verweis auf problematische Folgen 382 6.4.3 Die Frage nach Zielen und Mitteln 384 6.5 Fazit 385 Anhang 389 1. Sachregister 389 2. Namensregister 395 3. Abbildungsverzeichnis und -nachweis 400 |
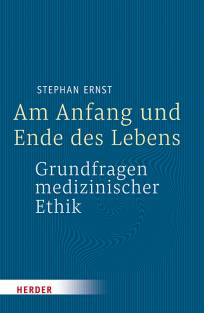
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen