|
|
|
Umschlagtext
Dieses Lehrbuch ist eine ebenso prägnant wie spannend geschriebene Gesamtschau der Allgemeinen Psychologie. Speziell auf die Bedürfnisse von Lesern ohne entsprechendes Vorwissen abgestimmt, hat es das Ziel, genügend Kenntnisse zu vermitteln, um psychologische Fragestellungen fundiert zu durchdenken und eigenständig gangbare Lösungswege zu finden.
Beginnend beim Bewusstsein und endend mit dem Willen werden in einer klaren Kapitelstruktur die neun psychischen Grundfunktionen beschrieben. Dabei wird auch die vielfältige Vernetzung innerhalb des psychischen Systems genauer betrachtet: Wie hängen Motivation und Lernen, Emotion und Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Motivation usw. zusammen? Viele Bezüge auf wichtige klassische Studien und alltagspsychologische Beobachtungen zu den jeweiligen Themen machen das Lehrbuch lebendig und anschaulich. Zur Vertiefung der Ausführungen sind am Ende jedes Kapitels einige Tipps mit Anregungen zum Ausprobieren, Anwenden und Nachdenken beigefügt. Sie sollen helfen, Brücken zwischen dem psychologischen Wissen und dessen Anwendung zu bauen. Das Buch richtet sich an Studenten der Psychologie im Haupt- und Nebenfach, aber auch an Praktiker und Wissenschaftler, die sich über die Grundfunktionen der menschlichen Psyche kompakt und lebensnah informieren wollen - wie z.B. Werbefachleute, Philosophen, Juristen, Theologen, Mediziner und Lehrer. KURT SOKOLOWSKI ist Professor für Allgemeine und Differentielle Psychologie an der Universität Siegen. Zuvor arbeitete er als Professor an den Universitäten Dortmund, Wuppertal, München und Osnabrück. AUS DEM INHALT: Einführung Was ist Psychologie? Bewusstsein Wahrnehmung Aufmerksamkeit Lernen Gedächtnis Problemlösen Emotion Motivation Volition Rezension
Die Allgemeine Psychologie hat neben der Entwicklungspsychologie die wohl größte Bedeutung für die und Nähe zur Pädagogik. Das Verhalten des Menschen ist der Gegenstand der Psychologie. Die Allgemeine Psychologie beschäftigt sich mit den wesentlichen Verhaltensweisen des Menschen, die in dieser Darstellung die zentralen Kapitel bilden: Bewußtsein, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Lernen, Gedächtnis, Problemlösen, Emotion, Motivation und Volition. Vorangestellt sind eine Einführung und das Kapitel "Was ist Psychologie?". Sprechen und Sprachverstehen und Psychomotorik begegnen hingegen nicht in eigenständigen Kapiteln. Insbesondere Motivation, Lernen und Problemlösen sind dabei auch pädagogisch und in der Schule von besonderer Bedeutung. Dieses Buch stellt die dazu notwendigen Theorien der Psychologie verständlich dar.
Thomas Bernhard für lehrerbibliothek.de Inhaltsverzeichnis
Vorwort 9
Kapitel 1 Einführung 11 1.1 Zum Thema 12 1.2 Ausgangslage und Problem 13 1.3 Ziel und Gratwanderung 14 1.4 Das Bewusstsein als Dreh- und Angelpunkt 15 1.5 Zum Buch 16 Kapitel 2 Was ist Psychologie? 19 2.1 Die psychologischen Schulen 23 2.1.1 Strukturalismus 24 2.1.2 Funktionalismus 26 2.1.3 Psychoanalyse 27 2.1.4 Behaviorismus 28 2.1.5 Gestaltpsychologie 29 2.1.6 Kognitive Psychologie 30 2.2 Psychologie als Wissenschaft 30 2.3 Natur- oder Geisteswissenschaft? 32 2.4 Erleben und Verhalten und das Dazwischen 37 Kapitel 3 Bewusstsein 41 3.1 Inhalte des Bewusstseins 43 3.1.1 Gefühle 44 3.1.2 Vorstellungen 46 3.2 Woher die Bewusstseinsinhalte stammen — auf der Suche nach dem Unbewussten 50 3.3 Wechsel der Bewusstseinsinhalte 54 3.4 Es wird anstrengend — die Kontrollierbarkeit der Bewusstseinsinhalte 58 3.5 Funktionen des Bewusstseins 60 3.5.1 Probebühne 1 — über das Jetzt und Hier hinaus 62 3.5.2 Probebühne 2 — eine andere Motivationslage 64 3.6 Das Rätsel bleibt 65 Kapitel 4 Wahrnehmung 67 4.1 Wie kommt die Welt in den Kopf? 69 4.2 Vom Auge zum Sehen 73 4.2.1 Farbe 74 4.2.2 Optische Täuschungen — Ich sehe was, das 80 4.2.3 Entfernungen und Tiefe 82 4.2.4 Form - Figur und Hintergrund 83 4.2.5 Wahrnehmung von oben - top-down 85 4.3 Nach den Dingen die Menschen - soziale Wahrnehmung 88 4.4 Wahrnehmung als Verhalten - Blickbewegungen 90 4.5 Ich sehe was, was ich nicht sehe - „blindsight" 93 Kapitel 5 Aufmerksamkeit 97 5.1 Aufmerksamkeit - ein Privileg des Menschen? 100 5.2 Selektion - das Eine aus dem Vielen 101 5.3 Kann man die Aufmerksamkeit teilen? 103 5.4 „Da fällt mir gerade ein ..." - zur unwillkürlichen Bewusstheit 108 5.5 Aufmerksamkeit - willkürlich und unwillkürlich 110 5.5.1 Anders als die Anderen 110 5.5.2 Ein Bedürfnis macht sich bemerkbar 113 5.5.3 Zusammenhalt im ständigen Wechsel 113 5.6 Ein Modell für alle Phänomene 114 5.6.1 Relevanz 115 5.6.2 Signifikanz 116 5.6.3 Pertinenz und Inpertinenz im Situationsmodell 116 5.6.4 Pegelsprünge und Regelbrüche im Situationsmodell 118 5.7 Welche Funktionen hat Aufmerksamkeit nun? 120 5.7.1 Mobilisierung 120 5.7.2 Integration 121 Kapitel 6 Lernen 123 6.1 Ein neuer Reiz - dieselbe Reaktion 126 6.2 Löschung - wie gewonnen so zerronnen? 128 6.3 Die Grundausstattung und ihre Folgen 129 6.4 Und wieder der kleine Albert 132 6.5 Reiz ist nicht gleich Reiz - das Genom spielt mit 134 6.6 Auch die Folgen des Tuns sind wichtig 135 6.7 Von der Reaktion zur Aktion - von respondent zu operant 136 6.8 Positive und negative Verstärkung 139 6.9 Löschung und Bestrafung 142 6.10 Vermeidungslernen - die Kombination macht es 143 6.11 Lernen durch Beobachtung - Modell und Vorbild 146 6.11.1 Zwei Phasen - vier Schritte 148 6.11.2 Vom Modell zum Vorbild 149 Kapitel 7 Gedächtnis 153 7.1 Wie alles anfing — mit der Ersparnismethode 157 7.2 Ich kann mich nicht erinnern — drei mögliche Ursachen 160 7.3 Der erste Schritt — Einprägen und Aufnehmen 161 7.4 Der zweite Schritt — Behalten und Speichern 165 7.4.1 Das sensorische Register — ein Ultrakurzzeitgedächtnis 165 7.4.2 Das Kurzzeitgedächtnis — ein flüchtiges Echo 167 7.4.3 Nachrichten aus der eigenen Vergangenheit — lang ist es her 168 7.5 Deklarieren öffentlich machen ich kann verkünden 168 7.6 Nichts zu deklarieren — Tatsächlich? 171 7.6.1 Schnelle Bewertungen und Reaktionen — das Assoziations-Gedächtnis 171 7.6.2 Automatisches Handeln — das prozedurale Gedächtnis 173 7.7 Bilder oder Wörter 174 7.8 Der dritte Schritt — Abrufen und Erinnern 175 7.8.1 Der erlebte Gedächtnisabruf — explizit 176 7.8.2 Der nicht erlebte Gedächtnisabruf — implizit 177 7.9 Erleichterung und Hilfe beim Erinnern 179 7.10 „Glücklich ist, wer vergisst" ? 180 7.11 Falsche Erinnerungen — nicht nur ein Problem von Zeugenaussagen 184 Kapitel 8 Problemlösen 189 8.1 Erste Versuche — Assoziationen 192 8.2 Lautes Denken — Was können die Gedanken über das Denken verraten? 194 8.3 Funktionale Gebundenheit 196 8.4 Kann man von Experten etwas lernen? 199 8.5 Jeder kann denken — auch Laien haben Theorien 202 8.6 Kausalattributionen — auf der Suche nach den Ursachen des Handelns 204 8.7 Von den Gedanken zum Gefühl — Intuition 208 8.8 Zusammenarbeit beim Denken — das Arbeitsgedächtnis 211 8.9 Das Problem mit dem Denken 214 Kapitel 9 Emotion 219 9.1 Was ist eine Emotion? 222 9.2 Wie entstehen Emotionen? 227 9.3 Emotionen und Aktivierung 229 9.4 Neues vom arbeitenden Gehirn: Zwei Wege führen zur Emotion 234 9.5 Welche Funktion haben Emotionen? 237 9.5.1 Bewertung 237 9.5.2 Verhaltensvorbereitung 238 9.5.3 Kommunikation — nicht nur nach außen 239 9.6 Von der Differenzierung zur Emotions-Kontrolle 241 9.7 Emotionen auf dem Prüfstand 242 9.8 Gefühlsansteckung — Empathie — Perspektivenübernahme 244 9.9 Elixiere des Lebens 246 Kapitel 10 Motivation 249 10.1 Instinkt — Bedürfnis — Trieb — Motiv 252 10.2 Natürliche Anreize — Kontakt, Abwechslung und Wirkung 256 10.3 Es wird spannend 257 10.4 Die doppelte Quantifizierung durch Motiv und Anreiz 259 10.5 Von der emotionalen zur kognitiven Seite der Motivation 262 10.6 Ziele, Absichten und Vorsätze 265 10.7 Flusserleben und intrinsische Motivation 270 10.8 Welche Grundmotive gibt es? 273 10.9 Hoffnung und Furcht — Aufsuchen- und Meidenmotivation 277 10.10 Am Ende noch einmal zurückgetreten — drei Handlungstypen 280 Kapitel 11 Volition 283 11.1 Wann braucht man den Willen? 287 11.1.1 Gewohnheit als innerer Widerstand 287 11.1.2 Unlust als innerer Widerstand 289 11.2 Der lange Atem — wozu der Wille gut ist 290 11.3 Erfolgreich Handeln 293 11.4 Vom Belohnungsaufschub zur Selbst-Kontrolle 295 11.5 Was macht der Wille? 296 11.6 Gedankenkontrolle — die willentliche Zensur vor uns selbst 299 11.7 Die Auswirkungen des Willenseinsatzes 303 11.8 Und was ist mit der Willensfreiheit? 304 11.9 Zur Philosophie des freien Willens 307 11.9.1 Eine Position: Determinismus 308 11.9.2 Eine Gegenposition: libertarische Freiheit 308 11.9.3 Eine dritte Position: Kompatibilismus 309 11.10 Jenseits von Bewusstsein und Gehirn 309 Literatur 313 Weiterführende Literatur 318 Register 321 Leseprobe: Vorwort Die Darstellung des gesamten Feldes der Allgemeinen Psychologie aus einer Hand birgt in sich die Gefahr der Oberflächlichkeit und Nivellierung. Insbesondere die enge Verbindung der Kognitions- und der Motivationspsychologie, die ich im Sinne hatte, machte einige Anpassungen und Vereinfachungen nötig. Hier mussten dann „Fünfe gerade sein". So möchte ich schon im Vorhinein um ein Pardon bei den Fachkollegen bitten, die Teile der vorliegenden Ausführungen lückenhaft oder unstimmig finden. Ich würde mich freuen, gerade hierüber Rückmeldungen zu erhalten. Bedanken möchte ich mich für die starken Impulse in meinem persönlichen und wissenschaftlichen Werdegang, der im Psychologischen Institut der Ruhr-Universität Bochum 1972 begann. Aus der kognitionspsychologischen Abteilung waren dies Eckart Scherer (t), Odmar Neumann und Wolfgang Prinz. Später kamen dann die Einflüsse aus der „Bochumer Schule der Motivationspsychologie" hinzu — allen voran Heinz Heckhausen (t) sowie seinen ehemaligen Mitarbeitern Julius Kuhl, Falko Rheinberg, Heinz-Dieter Schmalt und Klaus Schneider (t). Ihnen war selbst vielleicht gar nicht bewusst, welch starke Wirkung sie auf mich hatten — durch ihre jeweils besondere Persönlichkeit und ihr beeindruckendes Expertentum. Herausheben möchte ich besonders die Anregungen aus den vielen Gesprächen und Diskussionen mit Heinz-Dieter Schmalt. „Sollen wir noch einen Tee zusammen trinken?" war der Ausgangspunkt für viele hundert Teestunden —ohne Gebäck, aber mit Zigaretten. Dabei entstanden immer neue Fragen und Lösungsversuche, die zu einem stetig wachsenden Hintergrundwissen führten, das weit über publizierbare Gedanken hinausreicht. Darin sind die Ursprünge der Fundamente einer übergreifenden Allgemeinen Psychologie erwachsen, wie sie in dem vorliegenden Buch ausgeführt worden sind. Ebenfalls danken möchte ich den Teilnehmern der „Siegener Mittwochsakademie", für die ich regelmäßig Abendvorlesungen zu Themen aus der Allgemeinen Psychologie angeboten habe. Die darin aus langjähriger Lebenserfahrung erwachsenen interessierten Nachfragen haben — genauso wie die meiner deutlich jüngeren regulären Studenten — Schritt für Schritt die Alltagstauglichkeit des vorliegenden Buches erhöht. Nicht zuletzt deshalb, weil die über uns alle hergezogenen Rechtschreibreformen auch in mir Spuren der Unsicherheit hinterlassen haben, gilt mein Dank Carolin Quenzer, die mit großem Einsatz die ersten Fassungen durchmusterte und viele Ungereimtheiten fand. Am Ende möchte ich mich noch bei Kathrin Mönch vom Pearson Verlag für ihr stets freundliches und hilfreiches Entgegenkommen bedanken. Kurt Sokolowski Siegen, im August 2013 |
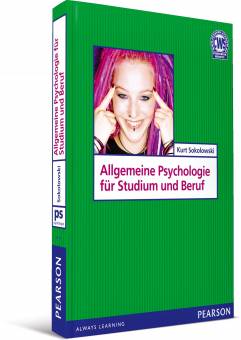
 Bei Amazon kaufen
Bei Amazon kaufen